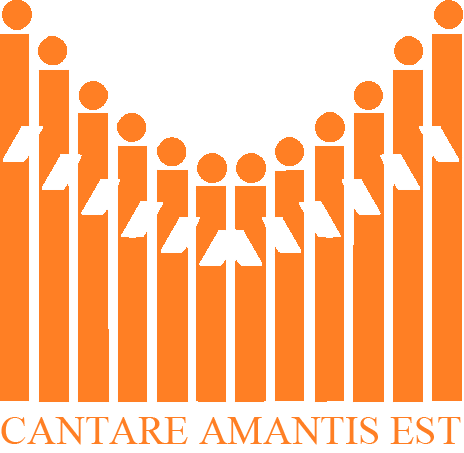Bruckner hatte bereits eine lange und sehr erfolgreiche musikalische Ausbildung (und einige, von ihm selbst nicht als „giltig“ anerkannte Messkompositionen) hinter sich, als er schließlich seine Messe „Nr. 1“ im Jahre 1864 komponierte, um sie zu Kaisers Geburtstag in Bad Ischl aufführen zu lassen. Das wäre der 18. August gewesen. Glücklicherweise wurde das Werk nicht rechtzeitig fertig, und so gelangte es zum Cäcilienfest am 20. November im alten Linzer Dom (heute: Ignatiuskirche) unter sicherlich weit günstigeren Bedingungen als in Bad Ischl zur Uraufführung. Mitwirkende: eine (große) Sängerauswahl aus den Linzer Gesangvereinen; Bruckner selbst dirigierte. Erstaunlicherweise wurde das Werk ein enormer Erfolg bei Publikum und Kritik, ja wurde sogar wenige Wochen später konzertant und mit ebensolchem Erfolg im Linzer Redoutensaal wiederaufgeführt.
Die Messe d-Moll wird oft als Bruckners „Schlüsselwerk“ bezeichnet, das nicht eine allmähliche Entwicklung zum Symphoniker zeigt, sondern mit einem Wurf alle Anlagen aufweist, die Bruckner – aus der Sicht der Nachgeborenen – zu einem jener wenigen Komponisten machte, welche die Gattung der Symphonie nach Beethoven und Schubert weiterentwickelten und das Musikschaffen des 20. Jahrhunderts entscheidend mitprägten. Bruckner war bereits 40, als er die d-Moll-Messe als sein erstes echtes Meisterwerk vorlegte. Sein Schaffen wird daher in die Zeit „vor 1864“ und „nach 1864“, also nach der d-Moll-Messe, eingeteilt. Anders als Bruckners ab 1872 entstandene letzte 8 Symphonien, die nach der noch erfolgreichen „Ersten“ von 1868 erst langsam und mühsam Anerkennung finden konnten, wurden die 3 großen Messen schon immer mit großem Erfolg aufgenommen – auch wenn sie die Möglichkeiten des kirchenmusikalischen Betriebes weit überforderten – und immer wieder auch konzertant aufgeführt.
„Die Musik hat mich so gefesselt, dass ich während ihres Erklingens nicht beten konnte!“, soll der Linzer Bischof Rudigier, der die Uraufführung im Dom ermöglicht hatte, nach dem Anhören der d-Moll-Messe gesagt haben. Das könnte daran liegen, dass Bruckners Musik nicht die Liturgie ausgestaltet, Gebet ermöglicht, sondern Gebet ist.
Für uns ist so eine Begeisterung nicht so leicht nachvollziehbar, schöpfen wir doch heute ständig aus dem Besten und Feinsten, was die Kirchenmusik im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat – und dieses Beste und Feinste wird jeden Sonntag in der Jesuitenkirche zur Aufführung gebracht. Doch muss man sich bewusst sein, dass damals seit Schuberts Messe in Es-Dur 36 Jahre lang kein an solche Meisterschaft heranreichendes Werk in der Kirchenmusik entstanden war. Die Presse beurteilte die Messe damals enthusiastisch als „…nach dem Ausspruche unserer bewährtesten Kunstsachverständigen das Ausgezeichnetste, was seit langem in diesem Fache geleistet wurde“. Und über die Aufnahme beim Publikum hieß es, „Auf manchen Hörer mag die Messe einen befremdenden Eindruck gemacht haben, weil der pathetisch schwungvolle Tonbau, die frische Rhythmik, das lebhafte Colorit der Instrumentation weit über die hergebrachte Form der gewöhnlichen Messen hinausgehen“. Die Befremdung hielt sich in Grenzen. Die Messe war sogar bei einer späteren Aufführung in Wien so erfolgreich, dass Bruckner deswegen den kaiserlichen Auftrag zur Komposition der f-Moll-Messe erhielt.
Was Bruckners Messen so sehr von denen anderer großer Komponisten unterscheidet, ist sein radikales Eintauchen in den Glaubenshintergrund des vertonten Messtextes. Während Schubert dies auf Grund seiner eigenen Glaubenszweifel nur in Teilen gelingt (vgl. das relativ nichtssagende „Et resurrexit“ in der Es-Dur-Messe), gibt es bei Bruckner kaum unausgedeuteten Text. Er geht so weit, Textbestandteile herauszugreifen, zu wiederholen, dafür den Duktus der Musik zu unterbrechen – und dadurch den Hörer geradezu mit der Nase auf den Inhalt zu stoßen, der sonst oft in der Formelhaftigkeit dieser immer wieder gehörten Texte untergeht. – „Et iterum venturus est cum gloria“, steht, vergleichsweise beiläufig, im Credo: „Er wird wiederkommen in Herrlichkeit“. Bruckner wiederholt die beiden Worte „cum gloria“ in den anderen beiden Messen, im dreifachen Forte schreit er es heraus. In der d-Moll-Messe wird es ebenfalls abgesetzt und unterstrichen, leitet aber direkt in das Drama des „Judicare“: Er wird wiederkommen, um zu richten. „Judicare – judicare – judicare“, werfen die Stimmen einander zu. 8 Jahre später, in der f-Moll-Messe, baut Bruckner diese Thematik zu einem Weltgerichtsdrama aus; und der vorangehende „Et resurrexit“-Teil erhebt sich dann nicht mehr aus der Bedrängnis wie noch in der d-Moll-Messe (die „et resurrexit“-Rufe des Chors in A-Dur erlösen uns aus dem d-Moll der Orchestereinleitung), sondern schafft die neue Realität der Auferstehung: Leben nach dem Tod (aus der leeren Oktavzerlegung e-h-e, der Ungewissheit, wird die Auferstehungswirklichkeit in strahlendem E-Dur).
So könnte man jede musikalische Phrase in Bruckners großen Messen ansehen und würde meist eine eindeutige Glaubensaussage darin finden. Einen guten Überblick über das, was Bruckner in der d-Moll-Messe macht, gibt im unten zitierten Text Thomas Dolezal, nunmehr Domkapellmeister zu Eisenstadt, in einer Messeinführung der Wiener Dommusik:
Die musikalische Aussagekraft der d-Moll-Messe ist überwältigend: Der Beginn erhebt sich ganz allmählich aus mystischem Dunkel, das sehnsüchtige Kyrie-Motiv streckt sich seufzend nach oben, als wolle es eine rettende Hand ergreifen, die sich im „Christe“ dann tatsächlich entgegenstreckt: die Umkehr des Kyrie-Motivs neigt sich herab und hilft (wieder) auf.
Im Gloria sei die abschließende Amen-Fuge herausgegriffen, deren Thema als Kreuzmotiv gestaltet ist. Vielleicht ist das (im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes) als Summa Summarum des Lobes zu verstehen, als Bekenntnis der gesamten Schöpfung: Nach sieben (drei+vier) Einsätzen in Grundgestalt kehrt sich das Thema um, das Kreuz ist auf den Kopf gestellt, überwunden.
Das Credo erstrahlt als musikalisches Kolossalgemälde, nahezu jeder Gedanke ist hier ausgedeutet, besonders anschaulich im Mittelteil: „Et incarnatus est“ (in himmlisch-abgehobenem Fis-Dur der Solisten; Anm. MF) über wiegenden Figuren der Instrumentalbässe, dazu echoartige Einwürfe der Oboen (Hirtenschalmeien), ein Wehen-Aufschrei der Chores bei „ex Maria“ und das Winden einer Gebärenden bei „et homo“ bis zum eigentlichen „factus est“, die dynamische Dramatik des „Crucifixus“, der hohle Abgesang der Holzbläser nach dem „et sepultus“ und die kurze Grabmusik (Äquale) der Blechbläser.
Die Vertonung des „Et resurrexit“ sucht ihresgleichen: vom ersten Vibrieren der Erde spannt sich über einem 33 Takte langen Orgelpunkt ein gewaltiger Bogen bis zur Wiederkunft Christi („venturus est cum gloria“); nahezu bedrohlich wird die Wirklichkeit des Endgerichts („Iudicare“) vor Augen geführt.
Nach dem strahlenden Bekenntnis des „et expecto resurrectionem“ und dem dumpfen Absinken beim Gedanken an den Tod („mortuorum“) klingt der Credo-Schluss „Et vitam venturi saeculi“ dann schon aus einer anderen Welt, verklärt und befreit. Dieses Erlösten-Motiv wird im „Dona nobis“ im Agnus Dei wiederkehren: Frieden, den die Welt nicht zu geben vermag – ein Blick in den geöffneten Himmel.
Die Chorvereinigung St. Augustin in der Jesuitenkirche singt in jedem Kirchenjahr alle 3 großen Bruckner-Messen; nun an den letzten beiden Sonntagen im November 2018 hintereinander die Messen in e-Moll und die in d-Moll als Abschluss und Höhepunkt. Die Pflege dieser Werke im steten Bestreben höchster musikalischer Ansprüche der Aufführungspraxis, um diese herausragend geglückte Verbindung von unvergleichlicher Musik und Glaubensaussage der Gemeinde in der Liturgie zugänglich zu machen, ist der Chorvereinigung ein ganz besonderes Anliegen.
Martin Filzmaier