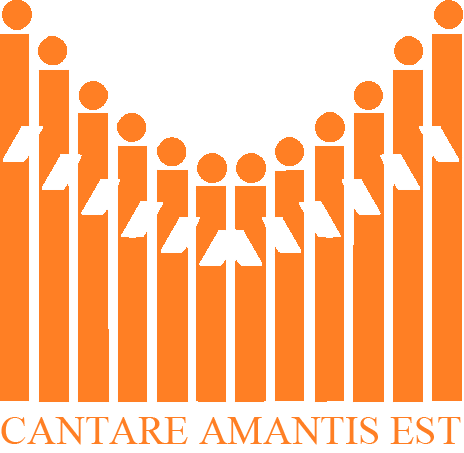Mit der geradezu bejubelten Aufführung der gloriosen Messe von Puccini am letzten Sonntag hat die Jesuitenkirche sich einmal mehr als die zentrale Pilgerstätte für höchst qualitätvolle Kirchenmusik in Wien erwiesen. Freilich ist das nicht allein das Verdienst der Chorvereinigung St. Augustin, für die ich hier sprechen darf. Auch das Wirken unseres Partnerchors, des Consortium Musicum Wien und die geglückte Verbindung mit Kirchenraum und dem pastoralen, genauer: dem homiletischen Wirken des Kirchenrektors, tragen entscheidend dazu bei, die Jesuitenkirche zu einem ganz besonderen Ort spirituellen Erlebens zu machen.
Die „Messa di Gloria“ von Puccini wird den Chor noch eine Zeitlang begleiten. Am 30. Juni wird sie im Rahmen unserer Chorreise von uns nach 3 Proben vor Ort unter der Leitung von Gustav Kuhn an der Accademia di Montegral nahe Lucca, Puccinis Geburtsstadt und Stätte seines frühen Wirkens, in einer vom Dirigenten speziell für uns neu erstellten Fassung ohne großes Orchester aufgeführt. Darüber wird dann natürlich noch gesondert zu berichten sein.
Was den Mai angeht, in dem wir wegen der Donnerstag-Feiertage gleich fünfmal zum Einsatz kommen, so finden Sie weiter unten wie gewohnt eine genauere Besprechung der zur Aufführung gelangenden Werke. Die „Trinitatismesse“ ist relativ neu in unserem Repertoire und auch keine von den Mozartmessen, die ein guter Chor auch schon einmal nur mit einer Verständigungsprobe singen kann. Da braucht es schon ein wenig eingehendere Beschäftigung – vielleicht sogar mehr als mit der anspruchsvolleren „Paukenmesse“, die wir aber relativ oft singen und daher nicht so intensiv proben müssen.
Ich wünsche Ihnen und uns für diese wunderbaren Werke jedenfalls – ja, wie darf man das sagen…? „Viel Vergnügen“…? Ich glaube, der Kirchenrektor würde lächeln und zustimmen.
Martin Filzmaier, Obmann
Donnerstag, 9. Mai 2024 Christi Himmelfahrt
Joseph HAYDN (1732 – 1809):
Missa in Tempore Belli C-Dur Hob. XXII:9 „Paukenmesse” (1796)
 Als Joseph Haydn 1795 von seinem neuen Fürsten Nikolaus der II. Esterházy die Nachricht erhielt, dass das Esterházy-Orchester neu gebildet würde und er seinen Posten als Kapellmeister wieder aktiv ausüben sollte, hielt er sich gerade in England auf. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass der Nachfolger des 1790 verstorbenen Nikolaus I., Paul Anton, die Kapelle aufgelöst und Haydn nur nominell als ihren Leiter behalten hatte.
Als Joseph Haydn 1795 von seinem neuen Fürsten Nikolaus der II. Esterházy die Nachricht erhielt, dass das Esterházy-Orchester neu gebildet würde und er seinen Posten als Kapellmeister wieder aktiv ausüben sollte, hielt er sich gerade in England auf. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass der Nachfolger des 1790 verstorbenen Nikolaus I., Paul Anton, die Kapelle aufgelöst und Haydn nur nominell als ihren Leiter behalten hatte.
Fürst Nikolaus II. verlangte von seinem Kapellmeister, abgesehen von den üblichen Routinediensten, nicht sehr viel. Allerdings sollte Haydn jedes Jahr zum Namenstag der Fürstin Josepha Maria eine neue Messe schreiben, die am darauffolgenden Sonntag in der Bergkirche zu Eisenstadt zelebriert wurde. Haydn verbrachte meist den Sommer in Eisenstadt, um das für den Herbst zur Aufführung vorgesehene neue Werk zu komponieren. Das Autograph der Messe ist sorgfältig mit den Angaben In Nomine Domini und Eisenstadt 796 [mpr]ia versehen.
Österreich stand mitten in dem unheilvollen Krieg, den Kaiser Franz II. gegen Frankreich führen musste; der junge General Napoleon Bonaparte errang einen Sieg nach dem anderen. Im August proklamierte die Wiener Regierung die allgemeine Mobilisierung und verhinderte jedes Friedensgespräch, bis der Feind in seine alten Grenzen zurückgeworfen sei. In dieser Zeit muss Haydn das aufpeitschende Agnus mit seinem unheimlichen Paukenpart geschrieben haben. „Missa in tempore belli“ bezeichnete Haydn das Werk auf dem ersten Blatt des Autographs (Esterházy-Archiv, jetzt National-Bibliothek Budapest).
Die Uraufführung der „Paukenmesse“ scheint am 13. September 1796 in Eisenstadt stattgefunden zu haben. Es ist aber auch möglich, dass die Paukenmesse zwar 1796 in Eisenstadt begonnen, jedoch erst im nächsten Jahr, als die Franzosen in Graz standen, beendet worden ist.
Ein zeitgenössisches Tagebuch erwähnt die Aufführung einer „Neuen Messe in C“ von Haydn am 29. September 1797 in der Bergkirche. Haydn-Forscher nehmen an, dass unsere Messe die im Jänner 1796 aufgeführte ist. Neue Beweismittel haben diese Annahme bestätigt. Wie bekannt ist, wurde eine neue Haydn-Messe am Stefanitag 1796 in der Piaristenkirche zu Wien aufgeführt. Es wurden zeitgenössische Stimmen zur Missa in tempore belli im Musikarchiv der Piaristenkirche gefunden.
Folgende Quellen sind vorhanden: das Autograph im Esterházy-Archiv in Budapest, alte Stimmen in den Archiven des Stiftes Klosterneuburg, der Piaristenkirche, der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, der Hofkapelle in Wien und der Erstdruck der Partitur von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Das originale Stimmenmaterial aus Eisenstadt war verloren gegangen. Es stellte sich jedoch heraus, dass es zusammen mit Bachs h-Moll-Messe in einen Schornstein gesteckt wurde, als die russischen Truppen 1945 das Schloss besetzten. Später konnte es, unbeschädigt, wieder entdeckt werden.
Ungeklärt war die Frage der Klarinetten-Stimmen. In den Musikarchiven der Hofkapelle zu Wien konnte authentisches Aufführungsmaterial gefunden werden, einschließlich der zusätzlichen Klarinetten-Stimmen von Klosterneuburg, die von Haydn selbst korrigiert sind. Offensichtlich sind diese Unterschiede zur originalen Eisenstadt-Fassung (= Autograph) in Wien und vielleicht auch auf spätere Aufführungen in Eisenstadt zurückzuführen.
Die die Trompeten verstärkenden Hörner-Stimmen befinden sich ebenfalls in dem Aufführungsmaterial der Wiener Hofkapelle, und zwar durch die ganze Messe hindurch, also nicht nur solistisch im Gloria und Credo.
Der Autograph enthält zum „Qui tollis“ im Gloria keine Flötenstimme. Sie taucht zum ersten Mal im Breitkopf-Material auf. Das Wiener Hofkapellen-Material bringt die Flötenstimme ebenfalls, und zwar ist sie dort von der Hand Johann Elßlers, Haydns Kopist, geschrieben; sie kann dadurch in ihrer Authentizität als sicher gelten.
Bei Aufführungen der Missa in tempore belli kann also zwischen der etwas herberen, aber dennoch wirkungsvollen originalen Eisenstadt-Fassung (ohne Flöten und verstärkende Hörner, Klarinetten nur im Credo) und der reich instrumentierten zweiten (Wiener) Fassung gewählt werden. Beide sind von des Meisters Hand.
Text: H. C. Robbins Landon im Vorwort zur Bärenreiter-Ausgabe (gekürzt).
Solisten sind: Monika Riedler, Martina Steffl, Alexander Kaimbacher, Klemens Sander
Sonntag, 12. Mai 2024
Franz SCHUBERT – Messe Nr. 3 in B-Dur, D 324 (1815)
 Franz Schubert hat seine dritte Messe in B-Dur im Jahr 1815 geschrieben. Seit einem Jahr war er als „Schulgehilfe“, also als ein untergeordneter Volkschullehrer angestellt. Die Jahre 1815 und 1816 gelten als Schuberts fruchtbarste „Liederjahre“, in denen er mehr Gedichte vertonte als in seinen nachfolgenden Lebensjahren. Es wird wohl immer ein Rätsel bleiben, wie Schubert neben den neun Stunden Dienst als Hilfslehrer mit einer solchen Intensität hatte schreiben können – als ob dieser Zwang den jungen Komponisten erst recht beflügelt hätte. Manchmal entstanden an einem Tag mehrere Lieder, besonders in den Monaten Juli und August 1815 oder etwa am 15. Oktober – allein an diesem Tag vertonte Schubert acht Lieder.
Franz Schubert hat seine dritte Messe in B-Dur im Jahr 1815 geschrieben. Seit einem Jahr war er als „Schulgehilfe“, also als ein untergeordneter Volkschullehrer angestellt. Die Jahre 1815 und 1816 gelten als Schuberts fruchtbarste „Liederjahre“, in denen er mehr Gedichte vertonte als in seinen nachfolgenden Lebensjahren. Es wird wohl immer ein Rätsel bleiben, wie Schubert neben den neun Stunden Dienst als Hilfslehrer mit einer solchen Intensität hatte schreiben können – als ob dieser Zwang den jungen Komponisten erst recht beflügelt hätte. Manchmal entstanden an einem Tag mehrere Lieder, besonders in den Monaten Juli und August 1815 oder etwa am 15. Oktober – allein an diesem Tag vertonte Schubert acht Lieder.
Die Kirchenmusik beschäftigte Schubert über seinen gesamten Schaffenszeitraum. Die meisten seiner liturgischen Werke jedoch – die ersten vier lateinischen Messen, mindestens 17 kleinere Stücke und das Fragment eines Requiems – entstanden innerhalb der ersten Schaffensjahre bis zum Jahre 1816, seinem 19. Lebensjahr. Die Kirchenwerke der Jahre 1814 bis 1816 lassen sich durch den Umstand erklären, dass Schubert als Hilfslehrer bei seinem Vater zu den Lichtentaler „Kirchenleuten“ gehörte. In der Zeit bis 1816 wird es Schubert wohl als seine Pflicht angesehen haben, für den Gottesdienst in der Lichtentaler Pfarrkirche zu komponieren, bestand doch über seinen Vater so etwas wie ein Beschäftigungsverhältnis.
Text aus dem Internet, Quelle unbekannt.
Als Solisten wirken mit: Cornelia Horak, Martina Steffl, Gernot Heinrich, Stefan Zenkl
Zum Offertorium singt der Chor „Ave Maria“ von Arcadelt.
Das (heute) bekannteste Werk des franko-flämischen Komponisten Jacob Arcadelt (1505-1568) ist „sein“ Ave Maria für vierstimmigen Chor. Dabei handelt es sich allerdings um einen der erfolgreichsten musikalischen Betrugsfälle des 19. Jahrhunderts: Der Opernkapellmeister und Chorleiter Pierre-Louis Dietsch hat den Chorsatz als seine Entdeckung ausgegeben und Franz Liszt komponierte darüber eine Orgelfantasie. Aber die holprige Textierung ist schon bald Grund gewesen, Dietsch als eigentlichen Autor zu vermuten. In der Tat handelt es sich bei der Melodie des Ave Maria – wie der Musikwissenschaftler André Pirro 1927 nachweisen konnte – um eine Bearbeitung des dreistimmigen weltlichen Chansons Nous voyons que les hommes von Arcadelt. Die geistliche Kontrafaktur und der romantische vierstimmige Chorsatz sind dagegen das Werk Dietschs.
Pfingstsonntag, 19. Mai 2023:
Joseph HAYDN – Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae
„Große Orgelsolomesse“ in Es, Hob. XXII:04 (1768)
 Kein anderer Todesfall eines Komponisten hat derartiges Aufsehen erregt wie der von Joseph Haydn (1732-1809) – wenn auch erst viele Jahre danach. Der Grund war, dass sein Schädel nach der Beerdigung aus seinem Grab verschwunden ist!
Kein anderer Todesfall eines Komponisten hat derartiges Aufsehen erregt wie der von Joseph Haydn (1732-1809) – wenn auch erst viele Jahre danach. Der Grund war, dass sein Schädel nach der Beerdigung aus seinem Grab verschwunden ist!
Haydn, der „Meister der Wiener Klassik“, starb vor 215 Jahren, am 31. Mai 1809 im Alter von 77 Jahren „infolge allgemeiner Entkräftung“ in seiner Wohnung in der heutigen Haydngasse 6 in Wien-Gumpendorf. Drei Tag nach der Beerdigung am Hundsturmer Friedhof in Meidling – an dessen Stelle sich der heutige Haydnpark befindet – wurde der Schädel des Komponisten aus seinem Grab gestohlen. Wie sich später herausstellen sollte, hatte Joseph Carl Rosenbaum, der ehemalige Sekretär des Fürsten Esterházy, den Auftrag dazu gegeben.
Rosenbaum war ein Anhänger der sogenannten „Schädellehre“ des Arztes Franz Joseph Gall, mit deren Hilfe anhand der Kopfform Haydns Genie ergründet werden sollte. An dem fragwürdigen Unternehmen waren neben Rosenbaum auch der Totengräber, ein Gefängniswärter und zwei Magistratsbeamte beteiligt, die das Grab bei Nacht und Nebel widerrechtlich öffneten und ihm den Schädel entnahmen.
Entdeckt wurde der Diebstahl erst, als Haydns sterbliche Überreste 1820 exhumiert und in die Bergkirche nach Eisenstadt überführt werden sollten. Im Jahr 1839 wurde der Schädel durch Rosenbaums Witwe an den Arzt Karl Haller übergeben, von diesem gelangte die „schätzbarste Reliquie“ 1852 dann an den berühmten Pathologen Carl von Rokitansky, der sie ebenfalls genau untersuchte.
Rokitanskys Söhne überließen den Schädel 1895 in den „unwiderruflichen immerwährenden“ Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde, die ihn neuerlich untersuchen ließ, und zwar durch den Anatomen und Wiener Gesundheitsstadtrat Julius Tandler.
Immerhin gelang es Tandler durch einen Vergleich mit Haydns Totenmaske die Echtheit des Schädels nachzuweisen. Im Jahre 1954 kam unter den Klängen der „Kaiserhymne“ endlich zur feierlichen Beisetzung des Schädels in Haydns Grab und damit zur Vereinigung mit den restlichen Gebeinen des Komponisten.
Georg Markus, Kurier, 2019
 Von Haydns insgesamt 12 erhalten gebliebenen Messen entstanden elf während seiner Tätigkeit als Kapellmeister in den Diensten der Fürsten Esterházy in Eisenstadt. 1766 starb Oberkapellmeister G.J. Werner, Haydn wurde 1. Kapellmeister und es oblag ihm nun auch die Betreuung der Kirchenmusik am fürstlichen Hof. Als Dank für seine Ernennung schrieb er eine Messe und widmete sie der Gottesmutter. Bislang nahm man an, dass es sich dabei um die „Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae“ (Große Orgelsolomesse in Es) gehandelt habe. Neuerdings vertreten einige Musikwissenschaftler die Meinung, es wäre die „Cäcilienmesse“ aus diesem Anlass entstanden und verlegen die Messe in die Jahre 1768/69. Da der erste Teil des Autographs (Kyrie, Gloria, Credo) verschollen ist, können wir uns hinsichtlich des genauen Titels des Werkes nur auf die Eintragungen im Entwurf-Katalog beziehen: „Missa in honorem B.M.V.“
Von Haydns insgesamt 12 erhalten gebliebenen Messen entstanden elf während seiner Tätigkeit als Kapellmeister in den Diensten der Fürsten Esterházy in Eisenstadt. 1766 starb Oberkapellmeister G.J. Werner, Haydn wurde 1. Kapellmeister und es oblag ihm nun auch die Betreuung der Kirchenmusik am fürstlichen Hof. Als Dank für seine Ernennung schrieb er eine Messe und widmete sie der Gottesmutter. Bislang nahm man an, dass es sich dabei um die „Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae“ (Große Orgelsolomesse in Es) gehandelt habe. Neuerdings vertreten einige Musikwissenschaftler die Meinung, es wäre die „Cäcilienmesse“ aus diesem Anlass entstanden und verlegen die Messe in die Jahre 1768/69. Da der erste Teil des Autographs (Kyrie, Gloria, Credo) verschollen ist, können wir uns hinsichtlich des genauen Titels des Werkes nur auf die Eintragungen im Entwurf-Katalog beziehen: „Missa in honorem B.M.V.“
Die Besetzung des Ordinariums entspricht dem Stand der fürstlichen Kapelle in den Jahren 1760/1770: 2 Englischhörner, 2 Hörner, Fagott, Streicher (ohne Violen), konzertierende Orgel, vier Solostimmen, gemischter Chor. Das Konzertieren der Orgel erfolgt nicht in allen Sätzen, eine dominierende Rolle spielt sie im Kyrie und im Benedictus, kleinere Orgelsoli finden sich am Ende von Gloria und Credo und im Dona nobis. Die Grundtonart des Werkes – Es-Dur – finden wir in der Kirchenmusik Haydns selten. Von den Messen steht nur die „Große Orgelsolomesse“ (zur Unterscheidung von der „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ = „Kleine Orgelsolomesse“ so genannt) in dieser ernsten Tonart. Die reiche kontrapunktische Arbeit zeigt den noch jungen Meister in der besten österreichischen Kirchenmusiktradition, in der die Chorfugen am Ende von Gloria und Credo (in dieser Messe auch im Dona nobis) auch nach der Stilwende um 1750 ihren festen Platz hatten.
Dem spätneapolitanischen Stil verpflichtet sind manche Soloteile, allerdings gelingt es Haydn immer, opernhaftes Gepräge zu vermeiden und die Grundstimmung des Textes auszuloten. Dies gilt auch für die tonmalerischen Elemente der Messe: Beginn des Gloria (piano, unisono bei „Et in terra“), auf das „Crucifixus“ (chromatischer Quartfall), auf das „Et resurrexit“ (aufsteigender Dreiklang), auf „sedet ad dexteram“ (Liegeton) und auf das plötzlich eintretende Moll bei „et mortuos“ verwiesen.
Auffallend ist, dass diese frühe Messe Haydns im 19. Jahrhundert sehr unterschiedlich bewertet wurde. Vollkommene Ablehnung und höchstes Lob stehen diametral gegenüber. Heute ist man sich einig, dass die „Große Orgelsolomesse“ eines der edelsten, gehaltsvollsten und andächtigsten Kirchenmusikwerke Haydns ist.
Friedrich Wolf + (aus dem Booklet zur CD, 1982)
Es musizieren mit uns die Solisten: Monika Riedler, Kathrin Auzinger, Samuel Robertson, Felix Pacher.
Zum Offertorium hören Sie die Kirchen-Sonate in F-Dur, KV 244.
Diese Kirchensonate aus dem April des Jahres 1776 ist die erste von jenen fünf Kirchensonaten, in denen Mozart die Orgel konzertierend eingesetzt hat. Für Organisten ist interessant, dass Mozart das Orgelsolo ausdrücklich mit der „Copula allein“ gespielt wissen wollte, einem nicht lauten und flötenartig klingenden Register. Diese Registrierungsangabe ist vielsagend für die Intonation von Mozarts Orgel, die Akustik im Salzburger Dom sowie für die Balance und Dynamik in der damaligen Aufführungspraxis.
Aus „Mozart sakral“, 2006
Sonntag, 26. Mai 2024
W. A. MOZART – Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis in C,
„Trinitatismesse“ KV 167 (1773)
 In der katholischen Kirchenmusikpraxis war es üblich, die Titel für Messen so zu wählen, dass daraus ersichtlich war, für welchen Heiligen oder für welches Fest sie komponiert wurden. Mozart hat dies nur ein einziges Mal gemacht, in seiner mit Juni 1773 datierten „Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis“ (Messe zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit). Sie ist auch die einzige Messe Mozarts, die ausschließlich den Chor und keine Solostimmen beschäftigt; derartige „Tutti-Messen“ waren keine Seltenheit, aber besonders hohen Festen oder großen Feierlichkeiten Vorbehalten (worauf hier auch die vier Trompeten hinweisen). Man mag wohl an eine Aufführung am Dreifaltigkeitssonntag denken, der im Jahr 1773 auf den 5. Juni gefallen ist, oder sich auch der Salzburger Dreifaltigkeitskirche erinnern, aber zum wirklichen Entstehungsanlass oder Uraufführungsort führen uns solche Spekulationen nicht. Mit dem Salzburger Dom hat diese Messe jedenfalls nichts zu tun.
In der katholischen Kirchenmusikpraxis war es üblich, die Titel für Messen so zu wählen, dass daraus ersichtlich war, für welchen Heiligen oder für welches Fest sie komponiert wurden. Mozart hat dies nur ein einziges Mal gemacht, in seiner mit Juni 1773 datierten „Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis“ (Messe zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit). Sie ist auch die einzige Messe Mozarts, die ausschließlich den Chor und keine Solostimmen beschäftigt; derartige „Tutti-Messen“ waren keine Seltenheit, aber besonders hohen Festen oder großen Feierlichkeiten Vorbehalten (worauf hier auch die vier Trompeten hinweisen). Man mag wohl an eine Aufführung am Dreifaltigkeitssonntag denken, der im Jahr 1773 auf den 5. Juni gefallen ist, oder sich auch der Salzburger Dreifaltigkeitskirche erinnern, aber zum wirklichen Entstehungsanlass oder Uraufführungsort führen uns solche Spekulationen nicht. Mit dem Salzburger Dom hat diese Messe jedenfalls nichts zu tun.
Auffällig sind ihre Proportionen. Mit 402 Takten ist das Credo praktisch genauso lang wie die übrigen Sätze der Messe zusammen. Es ist an sich sechsteilig gegliedert, wobei der erste, dritte und fünfte Abschnitt motivisch miteinander verbunden sind, der sechste die Schlussfuge ist, der zweite und vierte aber ein langsamer und schneller kontrastierender Einschub sind. Wie meist bei solchen Tutti-Messen fällt auch hier die überaus selbstständige und fein durchgearbeitete Behandlung des Orchesters auf, das in keiner Weise Begleitaufgaben hat, sondern geradezu in einem konzertierenden Prinzip dem Chor gegenübersteht.
Text aus „Mozart Sakral“, Begleitbuch zum Mozartjahr 2006, Herausgeber Peter Marboe.
Donnerstag, 30. Mai 2024 – Fronleichnam
W. A. MOZART: „Spatzenmesse“ KV 220 (1775)
Die spezifische Aufführungssituation im Salzburger Dom, wie sie durch Leopold Mozarts „Nachricht von dem gegenwärtigen Zustand der Musik Sr. Hochfürstlich Gnaden des Erzbischofs zu Salzburg im Jahr 1757“ bestätigt wird, rührte noch von der frühbarocken Praxis einer räumlich aufgefächerten Mehrchörigkeit, die zu Mozarts Zeiten allerdings schon reichlich obsolet war. An den mächtigen Kuppelpfeilern der Vierung im Salzburger Dom befanden sich bis zur Renovierung im Jahre 1859 vier Musikeremporen mit jeweils einer kleineren Orgel, auf denen die Solosänger und das Orchester Platz fanden: links vom Altar die Solisten, Posaunen, Fagotte, der Hoforganist, ein Kontrabass und der taktschlagende Hofkapellmeister, rechts die hohen Streicher und Oboisten. Die beiden übrigen Emporen waren bei festlichen Messämtern den traditionell unabhängigen Hoftrompeten samt Pauken reserviert, während der (Knaben-)Chor mit einer weiteren Continuogruppe aus Kontrabass und Orgelpositiv im Chorraum postiert war. Hinzu kamen die Sänger der Choralschola, welche die liturgische Zeremonie mit einstimmigen Gesängen bedienten und in Kurzmessen das Gloria und Credo mit der entsprechenden gregorianischen Melodie intonierten (Mozarts Komposition beginnt dann erst mit dem zweiten Vers).
Im Gegensatz zu Mozarts Partiturhandschriften, die nur den Verlauf selbständiger Stimmführungen festhalten, gibt der erhaltene Stimmensatz der Messe KV 220 ein genaues Bild dieser selbst für Salzburg einigermaßen kuriosen Besetzungsverhältnisse. Die beiden Continuogruppen auf der Empore und beim Chor erhielten eigene Noten mit genauen Anweisungen für Tutti- und Solo-Abschnitte. Und zumal die regelmäßige Mitwirkung der mit dem Chor colla parte geführten Posaunen und Fagotte, über die die Partituren nur selten Auskunft geben, kann anhand eigenständiger Spielparts eindeutig nachgewiesen werden.
Freilich erscheinen für den heutigen Interpreten weder die räumliche Disposition noch die Beschränkung auf Knabenstimmen – das eine ein Relikt veralteter Aufführungstradition, das andere die Spätfolge kirchlicher Frauenfeindlichkeit – als bindende Vorschrift. Zum ästhetischen Problem gerät dagegen die Frage, ob nur der nackte Notentext der „Neuen Mozart-Gesamtausgabe“ oder nicht eher die Dramaturgie der damaligen Salzburger Messzeremonie den Maßstab für eine Wiederbelebung Mozartscher Kirchenmusik abgeben sollte. Mozart selbst hatte in einem vielzitierten Brief an den Bologneser Kompositionsfachmann Giovanni Battista Martini darauf hingewiesen, dass in Salzburg zwischen die fünf Teile des Ordinariums (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus, Agnus) gewöhnlich eine Offertoriumskomposition und eine kurze „Sonata all’Epistola“ in Trio-Sonatenbesetzung eingefügt wurden, die nach der Lesung der meditativen Aufnahme der „Frohbotschaft“ dienen mochten. Als Teil einer planvollen lokalen Barockliturgie kann deshalb auch die Interpolation der Kirchensonaten KV 224 und KV 144 in die tonlich verwandten Messen KV 220 bzw. KV 140 einen weiteren Schlüssel zu Mozarts religiöser Funktionsmusik geben.
Die „Spatzenmesse“ entspricht dem Typus der Missa brevis für die gewöhnlichen Sonntage und kleineren Feiertage, die sich durch schmale Besetzung und knappe, zügige Durchkomposition des gebotenen Textes vom kantatenartigen Aufbau der festlichen Missae solemnes unterscheiden. Eine deutliche Binnengliederung (zumal im textintensiven Gloria und Credo) erreicht Mozart durch Tempowechsel und Tutti-Solo-Wechsel, motivische Einheitlichkeit durch die althergebrachte Variierung charakteristischer Melodietypen oder – wie in der Messe KV 220 – durch den zyklischen Rückgriff auf das Kyrie-Thema im Agnus Dei.
Während bei den frühen Messen aus den Jahren 1768/69 mit ihren reichlichen Tempowechseln und sorgfältig ausgearbeiteten Schlussfugati noch wie eine verkleinerte Kopie der spätbarocken Festmesse wirken, scheint in den Werken von 1773 bis 1775 bereits die aufklärerische Liturgiereform des neuen Erzbischofs Colloredo zu greifen. Dem Gebot der Textverständlichkeit sind kontrapunktische Partien und die obligatorischen Fugen am Schluss von Gloria und Credo gewichen. Mozart bemüht sich um instrumentale Charakteristik wie im Sanctus und Benedictus der C-Dur-Messe, die dem Werk einen wunderbar volkstümlichen Beinamen einbrachte: „Spatzen-Messe“.
Text: Michael Struck-Schloen im Booklet der CD von EMI 7 54100 2 (1990).
Als Solisten hören Sie: Cornelia Horak, Martina Steffl, Hiroshi Amako und Felix Pacher.
Zum Offertorium singt der Chor „Ave verum“ von W.A. Mozart. Mozart komponierte die Motette für Chor, Streicher und Orgel im Juni 1791, knapp ein halbes Jahr vor seinem Tod, während er zugleich an der „Zauberflöte“ und dem „Requiem“ arbeitete. Die Komposition war bestimmt für das Fronleichnamsfest in Baden bei Wien, wo Mozarts Frau Constanze zur Kur weilte. „Ave verum“ sind die als Titel dienenden Anfangsworte eines lateinischen Reimgebets zur Sakramentsverehrung, das den in der Eucharistie anwesenden Leib Christi grüßt, sein Erlösungsleiden preist und um seine Kraft in der Sterbestunde bittet. Man braucht nicht viele Worte darüber zu verlieren, dass es sich dabei um Mozarts zweifellos populärste kirchenmusikalische Komposition handelt, die den Hauch eines opus ultimum trägt.