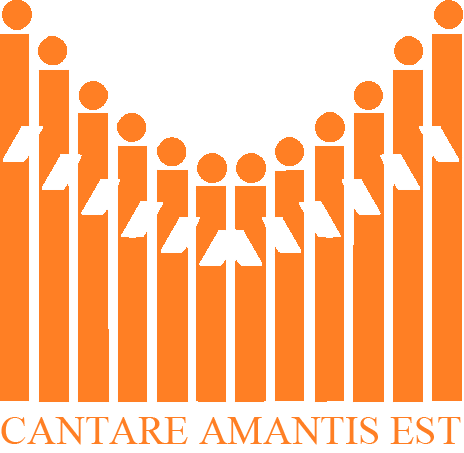Nur für den Fall, dass Sie diese Ereignisse versäumt haben – in aller nötigen Unbescheidenheit sei es hier gesagt: die beiden Aufführungen von Bruckners e-Moll-Messe im Hochamt mit dem Kardinal am 7., und dann beim Freiluftkonzert vor der Kirche am 8. waren unübertrefflich. Überwältigend. Höhepunkte unserer Tätigkeit. Berührende, mitreißende Erlebnisse für alle, die sangen, spielten und mitfeierten, bzw. zuhörten. Die exquisite Bläserbesetzung, die uns (wie fast immer, glücklicherweise!) zur Verfügung stand, ist bei dieser Messe schon die halbe Miete. Und der Chor war quantitativ und qualitativ verstärkt durch die jungen Stimmen vom Kammerchor des Musikgymnasiums Wien – wir freuen uns auf weitere zukünftige Projekte, wenn wieder einmal eine richtig große Besetzung notwendig ist. Brahms-Requiem hatten wir schon länger nicht, Verdi könnte man auch wieder überlegen…
Der September endet, und der Oktober beginnt mit Schubert. Herbstliches B-Dur am 6., dann am Sonntag darauf Haydns Schöpfungsmesse (auch in B). Herr Dvořák allerdings komponierte seine wunderbare Messe für Orgel und Chor in D-Dur. Wir singen das Ding aber wie gewohnt mit großer Orchesterbesetzung (s.u. im Artikel darüber). Eine große Messe wie diese in den Herbstferien anzusetzen, wo bekanntlich viele Mitwirkende einfach nicht da sind, war wider besseres Wissen meine Idee – wohl nicht die beste, aber: schau ma amal! Beethoven in relativ kleiner Besetzung am 22. September war so nicht geplant, hat aber auch funktioniert.
Das bringt mich wieder einmal auf das Thema: Wir haben zwar schon wieder eine passable Größe erreicht, aber da geht noch was! Wenn Sie selber stimmlich etwas beitragen können – oder jemanden kennen, der/die das vielleicht kann, geben Sie sich selber einen Ruck (oder dem/der Betreffenden einen Stesser, wie man in Wien sagt) und nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Es ist auch möglich, einfach zu einer Dienstagprobe zu kommen und sich auf Verdacht einmal da hineinzusetzen. Die Vermutung „die können das ja schon alle, und ich nicht“ könnte eine abschreckende Wirkung haben, was schlecht wäre. Denn erstens stimmt’s nicht (alle können’s noch nicht), und zweitens haben wir alle einmal so angefangen. Werkkenntnis ist keine Voraussetzung zur Mitwirkung. Musikalität, Noten lesen und richtig singen Können allerdings schon. – Probieren Sie es doch! – Sie sind herzlich willkommen!
Martin Filzmaier
Sonntag, 6. Oktober 2024: Franz SCHUBERT – Messe in B-Dur, D 324 (1815)
Wenn man Schuberts Messe in B ihrer Länge wegen als Missa brevis, ihrer Besetzung nach als Missa solemnis bezeichnet hat, so ist damit wohl weniger über diese einzelnen Faktoren – also Länge und Besetzung, die ohnehin Fragen aufwirft (Hörner und Posaunen allein im Kyrie) – ausgesagt, als vielmehr ein Hinweis gegeben über das spezifische Verhältnis zwischen Tradition und kompositorischem Anspruch. Zunächst verbreitet die Messe eine heitere Atmosphäre, wie das von einigen Kritikern im 20. Jahrhundert nicht nur dieser, sondern auch einigen Messen Mozarts vorgeworfen wurde, als ließe sich angeben, welches Maß an Heiterkeit und festlichem Gepränge einem geistlichen Werk zustünde und welches nicht. In einer Zeit und Umgebung, in der die Kirche ihre architektonisch-künstlerische Erscheinung prunk- und prachtvoll als theatrum sacrum umsetzte, ist solcher Vorwurf jedoch unangemessen. Kompositorisch hat Schubert sich hier eine doppelte kompositorische Aufgabe gestellt: sowohl an die Messtradition anzuknüpfen als auch ihre symphonischen Konzeptionen, die aus der Klassik stammen, zu verleihen. So folgen denn die fanfarenartig aufsteigenden Dreiklangsbrechungen, die Sechzehntelläufe im Gloria, der intimere Charakter des „Et incarnatus“ im Credo, die Gesanglichkeit des Benedictus und des Agnus Dei oder die dreiteilige Form von Gloria und Credo der Tradition; doch die Anlage der Sätze, die motivischen Verbindungen und tonalen Bezüge zwischen den Themen zeigen ein neues, aus der Klassik stammendes und für Schuberts spätere Messen in As- und Es-Dur entscheidendes symphonisches Denken. So enthält bereits das Kyrie in B-Dur eine interessante Überlagerung solcher Denkweisen. Es ist in langtradierter Weise dreiteilig angelegt und mit klassischen Elementen modernisiert: Der B-Teil, das „Christe eleison“ steht im dominantischen F-Dur, die textliche Reprise des „Kyrie eleison“ setzt zwar wie traditionell üblich mit einem Fugato ein, das jedoch rasch zugunsten eines homophonen Satzes aufgegeben wird. Aber nicht nur dieses verleiht dem Abschnitt einen modernen Charakter, auch sein Einsatz in Des-Dur, das über die zwei modulierten Akkorde rasch erreicht wird, und die folgenden Modulationen erinnern deutlich an eine klassische Durchführung. Dies wird vom vierten Abschnitt, der wörtlich einsetzenden und dann frei variierten Reprise des ersten Kyrie-Abschnittes, bestätigt. Ebenso enthält auch das Credo einen klassischen dreiteiligen Bau mit einer entsprechenden Motiv- und Themenbehandlung, wobei die eröffnende Orchestermotivik so erfunden ist, dass sie im „et resurrexit“ überzeugend die variierte Reprise einleiten kann. Und traditionell ist die Zweiteiligkeit des Benedictus, mit dessen Länge ein eigener, das Intime betonender Akzent in dieser Messe gesetzt wird; in der tonalen Gliederung, der Modulation zur Dominante für das zweite Thema und dem Einsatz der Reprise in der Dominante, deren erste Takte tonal als Rückleitung zur Tonika fungieren, ist jedoch die klassische Ausrichtung der formalen Anlage ganz deutlich.
Entstanden ist die Messe in B am Ende des Jahres 1815, das Kyrie im November, das Gloria im Dezember und die folgenden Sätze wohl kurz darauf, wie man aus der Datierung der ersten beiden Sätze schließen kann. Weiter darf man vermuten, dass Schubert sie für die heimatliche Lichtenthaler Kirche schrieb und berechtigt auf eine Aufführung durch Ferdinand Holzer hoffte, der im Jahr zuvor seine Missa solemnis in F-Dur dirigiert hatte und dem er auch noch den Druck seine C-Dur-Messe widmen sollte. Dokumentiert ist eine solche Aufführung aber weder direkt noch indirekt – etwa durch Stimmen, die aus diesem Jahr oder aus dem Archiv der Kirche stammen. Dennoch gibt es, abgesehen von den um 1820 datierten Stimmen, Anhaltspunkte, dass die Messe so ganz unbekannt nicht blieb. In einem Brief vom 6. Oktober 1824 berichtet Ferdinand Schubert nämlich seinem Bruder aus dem niederösterreichischen Hainburg, dass er dort zu einem Hochamt eingeladen worden sei, in dem eben diese Messe aufgeführt wurde. Auffälligerweise schreibt Ferdinand Schubert über den „Obristen vom dortigen Mineur-Corps, dessen Musikbande die Harmonie=Stimmen besetzte“. Da unter der Musikbande die militärische Kapelle zu verstehen ist, lässt diese Angabe vermuten, dass man Schuberts Messe womöglich mit weiteren Blasinstrumenten – eventuell gar in der Weise, wie es die Horn- und Posaunenstimmen im Kyrie nahelegen – bereichert hat. Sich wie hier an den zur Verfügung stehenden Instrumentalisten zu orientieren, wäre immerhin im Sinne der kirchenmusikalischen Praxis. Insgesamt deutet die Aufführung, die für Ferdinand Schubert ja offenbar überraschend war, darauf, dass es von der Messe Abschriften gab, sie also eine gewisse Verbreitung gefunden hatte.
Auf die Auslassungen von Textteilen in Gloria und Credo, wie das für Schubert, wenn auch in wechselndem Umfang charakteristisch ist, sei hier nur hingewiesen. In der B-Dur-Messe fehlen der Satz „Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram“, im Credo außer dem Bekenntnis im Credo zur Einheit der katholischen Kirche das Dogma „consubstantialem Patris“, das Auferstehungsdogma „Expecto resurrectionem mortuorum“ ist auf den eigenartigen und kaum sinnvoll zu übersetzenden Satz „Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum mortuorum“ verkürzt. Schuberts Kürzungen gehören ganz in das Denkklima seiner Zeit, hat man doch gerade Aussagen über das Jenseits und über die Eigenschaften Jesu wie seine Gottgleichheit im aufklärerisch geprägten Katholizismus gemieden, der sein Augenmerk stärker auf die irdische Glückseligkeit und den irdischen Nutzen eines gottgefälligen Lebens legte. Allerdings hat Schubert offenbar konsequenter als andere Komponisten diese Aussagen immer wieder in Frage gestellt.
Text: Manuela Jahrmärker, Vorwort im Klavierauszug des Carus-Verlages, München 2000.
Als Solisten hören Sie: Cornelia Horak, Eva Maria Riedl, Gernot Heinrich und Klemens Sander.
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Ehre und Preis“ von J.S.BACH.
Sonntag, 13. Oktober 2024: Joseph HAYDN – „Schöpfungsmesse“ (1801)
Vierzehn Jahre nach der Komposition der „Mariazellermesse“ sah sich Joseph Haydn durch seinen fürstlichen Dienstgeber Nikolaus Esterházy wieder veranlasst, den Ordinariumstext zu vertonen. Das Namensfest der Fürstin Hermenegild wurde jedes Jahr mit einem musikalischen Hochamt gefeiert. Sechs große Messen schrieb Haydn in den Jahren 1796 bis 1802 für diese Festlichkeiten, 1801 seine vorletzte, die sogenannte „Schöpfungsmesse“.
Das Autograph der Messe (Eigentum der Bayerischen Staatsbibliothek) trägt den schlichten Titel „Missa in bfa (B-Dur) und gibt uns auch Auskunft, dass Haydn mit der Komposition der Messe am 28. Juli 1801 begonnen hatte. Nur knapp sieben Wochen standen ihm bis zur Uraufführung des Werkes am 13. September 1801 in Eisenstadt zur Verfügung.
In einem Brief an den Wiener Musikalienhändler Weigl schrieb er aus Eisenstadt zwei Tage vor der Uraufführung: „…ich möchte Ihnen recht gerne ein mehreres schreiben, aber eben bin ich armer alter Knab mit einer neuen Meß, so übermorgen producirt werden muß beym Schluß…“. Über die Uraufführung gibt es keine zeitgenössischen Berichte.
Den Beinamen „Schöpfungsmesse“ verdankt das Werk einem Selbstzitat aus seinem 1798 uraufgeführten Oratorium „Die Schöpfung“. Haydns Biograph G. A. Griesinger berichtet dazu: „In der Messe, welche Haydn im Jahr 1801 schrieb, fiel ihm bei dem ‚Agnus Dei, qui tollis peccata mundi‘ ein, dass die schwachen Sterblichen doch meistens nur gegen die Mäßigung und Keuschheit sündigten. Er setzte also die Worte ‚Qui tollis peccata, peccata mundi‘ ganz nach der tändelnden Melodie der Worte in der Schöpfung: ‚Der Thauende Morgen, o wie ermuntert er!‘ Damit dieser profane Gedanke nicht zu sehr hervorstäche, ließ er unmittelbar darauf in vollen Chören das Miserere anstimmen.“
Griesinger irrt, wenn er das Zitat in das Agnus Dei der Messe legt, es beschließt den ersten Teil des Gloria.
Für die Aufführung der Messe in der Wiener Hofburgkapelle musste der Komponist auf Wunsch der Kaiserin die betreffenden Takte ändern. Haydn stand zur Zeit der Komposition der Schöpfungsmesse zweifellos auf dem Gipfel seines kompositorischen Könnens. Das zeigt sich in dieser Messe sowohl in der Art der Verwendung der eingesetzten Instrumente – es sei besonders auf die Holzbläser hingewiesen – als auch darin, wie Haydn den Chor, die Solisten und das Orchester in die motivisch-thematische Arbeit einbezieht.
Nicht Einzelsoli in Arienform stehen im Vordergrund, die Solisten werden dem Chor fast immer als Ensemble gegenübergestellt. Auffallend ist in der Schöpfungsmesse auch das reiche harmonische Geschehen, vor allem der häufige abrupte Wechsel in terzverwandte Tonarten und ins gleichnamige Moll.
Die formale Gliederung der einzelnen Ordinariumsteile bringt nicht wesentlich Neues. Wie in den meisten vorangegangenen Messen folgt auf die langsame Kyrie-Einleitung (28 Takte) ein schneller Teil (Allegro moderato, Takt 29-139) in dem das „Christe eleison“ auch von der Harmonik her einen sehr bestimmenden Charakter zeigt.
Im Gloria ergibt sich das Neue dadurch, dass auf das Zitat aus der Schöpfung ohne Unterbrechung der Adagiosatz mit dem eigentlichen „Qui tollis“ beginnt. Reiche Chromatik bringt das „Quoniam“ und die simultane Doppelfuge „In gloria Dei“, in der im letzten Unisono-Einsatz des Chores elf Töne der chromatischen Tonleiter erklingen.
Auch das Credo wird in drei große Abschnitte gegliedert. Besonderen Eindruck bringt der Wechsel vom lyrischen „Et incarnatus est“ zum Bass-Solo „Crucifixus“ und zum subito Forte vorgetragenen „sub Pontio Pilato“ des Chores.
Zart, fast geheimnisvoll ist der Beginn des Sanctus, in dem uns die Terzschritte der Holzbläser unwillkürlich an das Altsolo im Sanctus von Haydns Paukenmesse erinnern. Dem dramatischen „Pleni sunt coeli“ in Moll folgt befreiend der Jubel „Osanna“ von Solosopran und Chor.
Pastorale Züge trägt das in Es-Dur stehende Benedictus. Es wird nach der symphonisch wirkenden Orchestereinleitung vorwiegend vom Solistenquartett gestaltet. Insgesamt elf Mal bringen Orchester, Chor und Solisten den einprägsamen Themenkopf „Benedictus qui venit in nomine Domini“.
In keiner anderen Messe hat Haydn die drei Rufe „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi“ so wie in dieser Messe melodisch und harmonisch vollkommen ident gestaltet. Umso eindrucksvoller wirken dann die Unisono-Ausbrüche und die harmonischen Wendungen beim „Miserere“. Von besonderer Farbigkeit und Intensität ist durch den Wechsel von fanfarenartigen homophonen Abschnitten und fugierten Chorteilen das Ende des Werkes, das „Dona nobis pacem“.
Text: Prof. Mag. Friedrich Wolf im Booklet unserer CD ORF 279 (2001).
Diese Solist*en musizieren mit uns: Monika Riedler, Katrin Auzinger, Gernot Heinrich und Stefan Zenkl.
Zum Offertorium hören Sie die Kirchensonate F-Dur, KV 244
Diese Kirchensonate aus dem April des Jahres 1776 ist die erste von jenen fünf Kirchensonaten, in denen Mozart die Orgel konzertierend eingesetzt hat. Für Organisten ist interessant, dass Mozart das Orgelsolo ausdrücklich mit der „Copula allein“ gespielt wissen wollte, einem nicht lauten und flötenartig klingenden Register. Diese Registrierungsangabe ist vielsagend für die Intonation von Mozarts Orgel, die Akustik im Salzburger Dom sowie für die Balance und Dynamik in der damaligen Aufführungspraxis.
Aus „Mozart sakral“, 2006
Sonntag, 27. Oktober 2024: Antonín Dvořák, Messe in D-Dur op. 86 (1887)
Im Leben Antonín Dvořáks spielte die katholische Kirchenmusik eine wesentliche Rolle. An der „Orgelschule“ in Prag kirchenmusikalisch ausgebildet, wirkte er durch Jahre neben seinem Lehrer Josef Foerster als Organist an der Kirche St. Adalbert in Prag. Da er überzeugter Christ war, ist es nicht verwunderlich, dass er nach und nach eine Reihe bedeutender liturgischer Kompositionen schuf. Den Ordinariumstext hat er insgesamt dreimal vertont. In die Prager Studienzeit fallen die nicht erhaltenen Prager Messen in Es-Dur und f-Moll. Eine Reihe kleinerer Kirchenwerke könnten als Vorbereitung für das 1879 entstandene „Stabat Mater“ gesehen werden, das zweifellos als das bedeutendste Werk der ersten Schaffenshälfte gewertet werden muss und durch das der Komponist weit über seine Heimat hinaus bekannt wurde. Etwa ein Jahr vor der Messe in D-Dur (komponiert im Frühjahr 1887) hatte Dvořák das große tschechische Oratorium „Sancta Ludmilla“ vollendet. An wichtigen Kirchenwerken folgten der Messe noch das Requiem, ein „Te Deum“ und sechs biblische Gesänge über Psalmentexte.
Zur Komposition der Messe war Dvořák durch den Prager Architekten Josef Hlavka veranlaßt worden. Bei der Einweihung der neu erbauten Kapelle in Hlavkas Schloß in Luzany am 11. September 1887 erfolgte die Uraufführung des Werkes unter der Leitung des Komponisten.
Dvořák hatte die Messe für gemischten Chor, Soli und Orgel geschrieben. Da der englische Verleger Novello, dem Dvořák das Werk zur Drucklegung angeboten hatte, auf einer Orchesterfassung bestand, instrumentierte der Meister 1892 die Messe (2 Oboen, 2 Fagotte, 3 Hörner, 3 Posaunen, 2 Trompeten, Pauken, Streicher). Von der ursprünglichen Orgelstimme blieben nur wenige Takte im Gloria und das meditativ angelegte Vorspiel zum Benedictus erhalten. In der Orchesterfassung erklang das Werk erstmals öffentlich am 11. März 1893 im Londoner Kristallpalast.
Die Architektonik der Messe hat ihre Wurzeln in den formalen Gegebenheiten der Kirchenmusik der Wiener Klassik. Auffallend ist eine Vorliebe für polyphones Gestalten. Nachahmungen, Fugati und kanonartige Abschnitte finden sich in allen Sätzen. Doch stehen alle kontrapunktischen Kunstfertigkeiten im Dienste einer volksliedhaften Melodik.
Pastorale Stimmung vermittelt das im 6/4 Takt komponierte Kyrie. Der festlich jubelnde Charakter im Gloria wird nur im Mittelteil („Gratias agimus“ – Orgelbegleitung) etwas zurückgedrängt. Der Soloalt stimmt im Credo die einzelnen Glaubenssätze an, der Chor wiederholt und stärkt so das Bekenntnis. Nur die leidenschaftlichen Ausbrüche beim „Crucifixus“ und die fugierten Einsätze beim „Et iterum“ und beim „Et vitam“ bilden hier eine Ausnahme.
Auf das durch Imitation und Modulation gekennzeichnete Sanctus folgt ein verinnerlichtes Benedictus (Orgel, Streicher, Chor). Zu gewaltigen Steigerungen führen Solostimmen und Instrumente das komplizierte musikalische Geschehen im Agnus Dei. Erst das von den Sopranen vorgetragene „Dona nobis pacem“, einer kontrapunktischen Gegenstimme zu den Solisten entnommen, führt zu einem besinnlichen, im Pianissimo verklingenden Schluß.
Text: Prof. Mag. Friedrich WOLF aus dem Booklet unserer CD („alte“ Rechtschreibung unverändert)
Als Solisten wirken mit: Ursula Langmayr, Katrin Auzinger, Junho You, Yasushi Hirano
Montag, 1. Nov 2024, Allerheiligen: Franz SCHUBERT – Messe Nr. 2 in G-Dur (1815)
Die Messe Nr. 2 in G-Dur D 167 ist eine Messvertonung für Soli, Chor und Orchester von Franz Schubert aus dem Jahr 1815.
Laut Eintrag im Partitur–Autograph komponierte der gerade 18-jährige Schubert die Messe in weniger als einer Woche, vom 2. bis 7. März 1815. Da er dafür die Arbeit an seiner 2. Sinfonie unterbrach, darf angenommen werden, dass Schubert für die Messe einen Kompositionsauftrag erhalten hatte. In der Erstfassung war für das Orchester nur eine am Wiener Kirchentrio (2 Violinen und Basso continuo, hier erweitert um die Bratsche) orientierte kleine Besetzung vorgesehen. Vermutlich wurde das Werk in dieser Form erstmals 1815 unter Schuberts eigener Leitung in der Lichtentaler Pfarrkirche aufgeführt.
Zu einem nicht genau bestimmten späteren Zeitpunkt erweiterte Schubert die Besetzung des Werks um Trompeten und Pauken. Da Eusebius Mandyczewski, der Herausgeber des Werks, im Rahmen der alten Schubert-Gesamtausgabe (1887) diese Erweiterungen für unecht hielt, nahm er nur die Erstfassung in die Edition auf, was für die kommenden Jahrzehnte für die Rezeption der Messe bestimmend blieb. Erst in den 1980er-Jahren wurde der originale Stimmensatz von der Hand Franz Schuberts mit den instrumentalen Erweiterungen in Klosterneuburg wieder aufgefunden, wo am 11. Juli 1841 die erste nachweisbare Aufführung dieser Fassung stattgefunden hatte.
Der Erstdruck der Messe erfolgte 1846, allerdings fälschlicherweise unter dem Namen des früheren Prager Domkapellmeisters Robert Führer, der kurz zuvor seine Stelle wegen Betrugs verloren hatte und später wegen diverser Vergehen im Gefängnis landete. Schuberts Bruder Ferdinand forderte daraufhin 1847 in einem Zeitungsartikel die Richtigstellung, die bei der nächsten Auflage des Drucks erfolgte.
Ferdinand Schubert erweiterte 1847 seinerseits die Besetzung der Messe nochmals um Oboen (oder Klarinetten) und Fagotte.
Die Messe ist überwiegend homophon und liedhaft gesetzt und somit auf die Möglichkeiten einer kleineren Kirchengemeinde hin ausgerichtet. Nur das Benedictus ist als dreistimmiger Kanon angelegt, und die Osanna-Abschnitte von Sanctus und Benedictus sind als Fugati komponiert.
Wie in allen seinen lateinischen Messvertonungen lässt Schubert im Credo den Satz “Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam” (deutsch: „[Ich glaube an] die eine heilige katholische und apostolische Kirche“) aus, sowie – gleich mit fast allen anderen seiner lat. Messen (mit Ausnahme seiner ersten in F-Dur) – auch den Satz “Et expecto resurrectionem mortuorum” (deutsch: „Ich erwarte die Auferstehung von den Toten“), und gibt damit seinen ganz persönlichen Vorbehalten gegenüber bestimmten zentralen christlichen Glaubenssätzen Ausdruck.
Die G-Dur-Messe gehört heute zu den meistaufgeführten kirchenmusikalischen Werken Franz Schuberts.
Text aus Wikipedia
Solistin und Solisten: Elisabeth Wimmer, Alexander Kaimbacher, Klemens Sander
Dirigent: Tom Böttcher