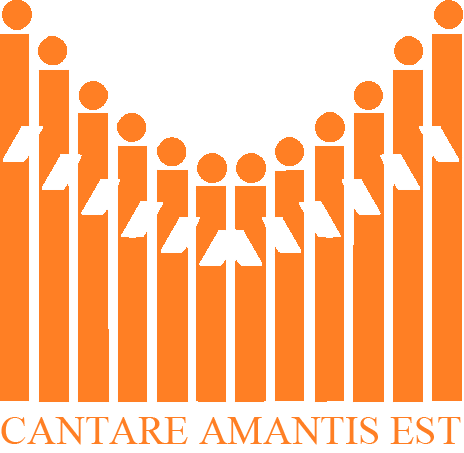Der November ist in dieser Herbstsaison für uns vielleicht der entspannteste Monat: nur eine große Messe – aber die hat es dafür in sich. Während die Messen am 1., 3. Und 10. quasi Standardrepertoire sind, ist allseits der Respekt vor den Herausforderungen von Bruckners f-Moll-Messe sehr groß. Bei den „alten“ Sänger*innen, weil wir die Messe schon lange nicht auf dem Programm hatten, bei den neuen, weil viele von ihnen das Werk („zu lang und unmöglich zum Singen“, meinte vor 156 Jahren der Leiter des Singvereins beim ersten Versuch, sie einzustudieren) überhaupt zum ersten Mal in der Hand haben; beim Chorleiter, weil der zwar keinen eigenen Probensamstag angesetzt hat, aber Teile einiger Dienstagproben seit Oktober der (Neu)einstudierung widmet, weil sich das sonst nicht ausgeht; und schließlich beim Vorstand, der mit Blick auf die Kosten ein flaues Gefühl im Magen bekommt.
Die Messe wurde oft – durchaus anerkennend – als „Symphonie mit obligatem Chor und Solisten“ bezeichnet. In ihrer Dimension von gerade noch in der Liturgie spielbaren Werken ist sie nur mit Schuberts Messe in Es vergleichbar. Bruckners Werk dauert – je nach Interpretation – zwischen 55 und 77 (!) Minuten (letzteres unter Celibidache). Die Instrumentalbesetzung ist die eines Symphonieorchesters. Warum Bruckner für das alles so viel länger braucht als die meisten anderen Messkomponisten, und warum dieses Werk so außerordentlich und ein absolutes kirchenmusikalisches Ereignis ist, können Sie in meinen Begleittext zu unserer neuen CD und auch der Sonderausgabe des „Sonntagszettels“ zu Christkönig entnehmen.
Regelmäßig aufgeführt wird die Messe außer bei uns in der Jesuitenkirche auch im Stephansdom und in St. Augustin. Dort, weil es dafür seit der an diesem Ort erfolgen Uraufführung 1872 eine Tradition gibt, die wir bei unserer Abwanderung 1993 in die Jesuitenkirche weitergetragen haben. Und im Dom, weil dort großzügig Mittel für umfangreiche Probentätigkeit mit (wie bei uns) bezahlten Musikern zur Verfügung stehen. Im Bruckner-Jahr 2024 konnten Sie die Messe wohl auch noch in anderen Kirchen hören, wo sie für eine einmalige Aufführung einstudiert wurde. Aber ich wage zu behaupten, dass sie das Werk in keiner Kirche in der Qualität hören werden wie bei uns. Ich möchte jetzt nicht schon wieder Eigenlob über den Chor ausschütten (auch, wenn es berechtigt wäre); aber bei einer Messe, die für ein Symphonieorchester geschrieben wurde, auch wie bei uns tatsächlich ein (hervorragendes) Symphonieorchester zur Verfügung zu haben, macht dann schon einmal einen Unterschied. Während das Hofopernorchester 1868 den zeitgenössischen Schmarrn aus Linz (meine Interpretation dieser Ablehnung) als „unspielbar“ bezeichnete, setzt sich das Orchester der Chorvereinigung St. Augustin um halb neun hin, macht eine ausführlichere Verständigungsprobe mit Chor und Solisten, und sorgt um halb elf für ein Ereignis!
Ob es mit der oberösterreichischen Herkunft unseres Musikalischen Leiters zu tun hat, weiß ich nicht sicher; aber er hat immer wieder bewiesen, eine sehr gute Hand für Bruckner zu haben – zuletzt bei den fulminanten Aufführungen der e-Moll-Messe. – Freuen Sie sich wie wir auf diesen Höhepunkt des zu Ende gehenden Kirchenjahres!
Ein kurzer Ausblick auf den Dezember sei noch erlaubt, der sonst immer ein ruhigerer Monat für uns ist. Diesmal nicht. Wir singen am Marienfeiertag Bruckners Messe in d-Moll – auch für die Meisten eine Neueinstudierung, weil schon lange nicht gemacht. Danach dann eine „echte“ Neueinstudierung, Michael Haydns Hieronymusmesse, die schon lange einen Platz im Repertoire verdient hätte. Und inzwischen nimmt auch unser Adventkonzert am 20. Dezember Gestalt an, und die ist vielversprechend.
In der Jesuitenkirche gehört zu „dem, was Sie hier erfahren können“ (P. Schörghofer) das gesungene und das gesprochene Wort. Das Adventkonzert wird dieser Vorgabe folgen. Lesungen und Musik. Johannes Silberscheider wird diesen Abend mit uns gestalten. Er hat uns vor wenigen Tagen besucht und aus den Werken vorgelesen, die er verwenden möchte. Die meisterliche Vortragskunst dieses zutiefst sympathischen und auch tief gläubigen Mannes zu erleben, seine Gedanken dazu zu hören, das war schon bei dieser Begegnung aufregend und bewegend. – Merken Sie sich den Termin unbedingt schon vor! Eine schönere Vorbereitung auf das Fest werden Sie kaum finden.
Herzlichst, Ihr
Martin Filzmaier
Sonntag, 3. November 2024:
Joseph HAYDN – „Kleine Orgelsolomesse“ (1777)
 Neben den berühmten sechs späten, zwischen 1796 und 1802 entstandenen Messen hat Haydn noch weitere acht Messkompositionen hinterlassen, die zwischen 1750 und 1782 komponiert wurden und zumeist in späteren Abschriften erhalten sind; die Authentizität dieser Werke ist unbestritten.
Neben den berühmten sechs späten, zwischen 1796 und 1802 entstandenen Messen hat Haydn noch weitere acht Messkompositionen hinterlassen, die zwischen 1750 und 1782 komponiert wurden und zumeist in späteren Abschriften erhalten sind; die Authentizität dieser Werke ist unbestritten.
Eine kompositorische Besonderheit verbindet die beiden Messen Hob. XXII:04 und XXII:07, nämlich die besondere Rolle der Orgel als virtuoses Soloinstrument. Haydn greift damit insbesondere die französische Tradition auf, die ihm durch die Messkompositionen seines älteren Wiener Kollegen, des Hofkapellmeisters Georg Reuter (1708-1772), bekannt geworden sein dürfte.
Die „Kleine Orgelsolomesse“ genannte Missa brevis Sancti Joannis de Deo dürfte zwischen 1775 und 1778 komponiert worden sein. Auftraggeber war aller Wahrscheinlichkeit nach der Orden der Barmherzigen Brüder, als deren Schutzheiliger Johannes Ciudad, der den Beinamen „de Deo“ erhielt, fungiert. Das Werk ist äußerst knapp gehalten; Haydn verzichtet weitgehend auf Vokalsoli und verwendet lediglich das „Wiener Kirchentrio“ (2 Violinen, Bass, Orgel) für die Begleitung. Auf ein langsames Kyrie folgen mit Gloria und Credo zwei an sich textreiche Abschnitte, die jedoch dadurch gerafft wirken, dass Haydn die Texte teilweise übereinanderschichtet. Diese auch bei einer „Missa brevis“ unübliche Kürzung hat dazu geführt, dass sein Bruder Michael Haydn noch 1795 das Gloria sozusagen „auskomponierte“. Etwas breiter ausgeführt ist wieder das „Incarnatus“, während Sanctus und Agnus Dei ebenfalls knappgehalten sind. Einzig Raum für solistische Entfaltung bietet erneut das Benedictus, und hier hat Haydn einen durchaus „modernen“ konzertierenden Ariensatz für Orgel und Begleitung geschrieben; er bildet in seiner diesseitig-lebensbejahenden Haltung einen deutlichen Kontrast zu den eher formalhaften, aber stets detailliert ausgeformten Chorsätzen.
Text: Wulf Konold im Booklet der CD Philips 420 162-2 (1987).
Solistin: Cornelia Horak
Am Orgelpositiv: Maximilian Schamschula
Sonntag, 10. November 2024:
W.A.MOZART – Missa solemnis in C, KV 337
Der Autograph von Mozarts letzter vollständiger Vertonung des lateinischen Ordinariumstextes trägt das Entstehungsdatum „nel Marzo 1780 in Salisburgo“. Zusammen mit der Kirchensonate KV 336 war die Messe KV 337 für das feierliche Osterhochamt im Salzburger Dom bestimmt. Die Bezeichnung „solemnis“, die nicht von Mozart stammt, sondern im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte beigefügt wurde, bezieht sich auf die reiche Besetzung des Orchesters mit Oboen, Fagotte, Trompeten, Pauken und Streicher. Dominiert bei der „Krönungsmesse“ der prächtige Klang der Blechbläser, so geben bei KV 337 die Holzbläser dem Werk einen mehr kammermusikalischen, introvertierten Charakter, der besonders im melodiösen Agnus Dei in der konzertierenden Anlage von Sopran-Solo, Oboe, Fagott und Orgel, begleitet von sordinierten (gedämpften) Streichern, zum Ausdruck gebracht wird. Anklänge an die Cavatine der Gräfin „Porgi, amor, qualche ristoro“ aus „Le nozze di Figaro“ prägen das Agnus Dei, das in einem Sopransolo Gelassenheit und melodische Eindringlichkeit versprüht, bevor es im Piano verklingt.
Diese Solisten musizieren mit uns: Ursula Langmayr, Eva-Maria Riedl, Hiroshi Amako, Stefan Zenkl
Zum Offertorium hören Sie die Kirchensonate in C-Dur, KV 336.
In seinen Kirchensonaten KV 244, 245, 263, 328 und 329 hat Mozart dem Organisten nicht nur die improvisatorische Ausführung des Continuo-Parts überantwortet, sondern ihn auch mit solistischen Aufgaben größerer und kleinerer Art bedacht. Seine letzte Kirchensonate, KV 336, ist hingegen ein wenn auch kleines, so doch veritables Orgelkonzert, natürlich nur einsätzig, wie alle Kirchensonaten Mozarts. Die Continuo-Aufgaben hat bei diesem Werk eine zweite Orgel übernommen, das auf der Empore des gegenüberliegenden Kuppel-Pfeilers im Salzburger Dom befindliche Instrument.
Diese Kirchen- oder Epistelsonate – so wurden die Kirchensonaten auch genannt, weil sie im feierlichen Hochamt nach der Epistel anstelle des Gradual-Gesanges erklungen sind – ist im Autograph von Mozart mit März 1780 datiert und damit die einzige Kirchensonate, von der man sagen kann, dass der konzertierende Orgelpart vom Komponisten für sich selbst in seiner Funktion als Salzburger Hoforganist geschrieben wurde. Den Kompositions- und Uraufführungsanlass kennen wir nicht; bei einer im März entstandenen kirchenmusikalischen Komposition wäre es naheliegend, an den Ostersonntag zu denken. Das ist aber bei der bescheidenen Streicherbesetzung nicht möglich, weil diese nicht den Besetzungstraditionen für ein festum pallii entspricht. Vielleicht war es aber das feierliche Hochamt am Ostermontag?
Christkönigsonntag, 24. November 2024:
Anton BRUCKNER – Messe Nr. 3 in f-Moll (1872)
Von einem bewussten Archaisieren, wie es der Cäcilianismus als musikalisches Gegenstück zur Neogotik in der Architektur des 19. Jahrhunderts forderte, hatte Anton Bruckner in seiner geistlichen Chormusik Abstand genommen. Dank des behutsamen Einsatzes einer modernen romantischen Harmonik scheint der Gegensatz von restaurativ und progressiv aufgehoben. Allerdings wären seine Motetten ohne die Auseinandersetzung mit dem Stil Palestrinas und dessen Zeitgenossen kaum geschrieben worden. Und auch der zur Einweihung einer Votivkapelle des Linzer Domes komponierten e-Moll-Messe für achtstimmigen gemischten Chor und Bläser bekannte sich Bruckner weitgehend zur Chorpolyphonie alter Meister.
Bei einem Vergleich mit der d-Moll-Messe aus dem Jahr 1864 und der kurz vor der Übersiedlung nach Wien vollendeten f-Moll-Messe kommt der archaisierenden e-Moll-Messe jedoch eine Ausnahmestellung zu. Denn in der d-Moll-Messe so gut wie im reifen Meisterwerk der f-Moll-Messe behandelt Bruckner die orchestralen Klangmittel ähnlich virtuos wie in den Symphonien. Auch wenn der Primat des Vokalen bei voller Präsenz des sakralen Textes stets gewahrt bleibt, spricht vieles für eine typisch symphonische Konzeption. Aufreibende Arbeit während des „Schaffensschubes“ der Jahre 1864 bis 1868, berufliche und private Enttäuschungen zudem, hatten Bruckner in eine schwere seelische Krise gestürzt. Wie ein Brief an den Freund Rudolf Weinwurm vom 19. Juni 1867 verrät, fürchtete er geradezu „Irrsinn“ als mögliche Folge nervlicher Überreiztheit. Doch ein neuerlicher mehrmonatiger Kuraufenthalt in Bad Kreuzen gab ihm 1868 die Arbeitskraft wieder zurück.
Noch vor jener Kur hatte Bruckner die Arbeit an der f-Moll-Messe in Angriff genommen, in deren „Kyrie“-Rufen sich eigenes Erleben zu spiegeln scheint. Vollendet wurde die Messe dann am 9. September 1868. Doch erst nach einer Überarbeitung, die sich hauptsächlich auf die Instrumentation der Bläser bezog, dirigierte Bruckner am 16. Juni 1872 die Uraufführung in der Wiener Augustinerkirche. „Die Messe Pruckner‘s ist eine Komposition, die von der Erfindungskraft und dem ungewöhnlichen Können des Komponisten das rühmlichste Zeugniß ablegt“, befand Ludwig Speidel im Wiener „Fremdenblatt“. „Mit poetischem Verständniß hat er sich in die vom Meßtexte geschaffenen Situationen vertieft und seine enorme kontrapunktische Kunst macht es ihm leicht, die schwierigsten Probleme spielend zu lösen.“ Kritik forderte allerdings Bruckners vermeintliche Neigung heraus, sich von dem „dramatischen Gehalte des Textes verführen“ zu lassen und dabei „hin und wieder an das Theatralische zu streifen“. „Mitten in einer christlichen Wolfsschlucht“ glaubte sich der Rezensent dabei an einer Stelle des Credo zu finden.
Wenn nicht alles täuscht, dürfte Ludwig Speidel dabei das „Resurrexit“ im Sinn gehabt haben. Oder präziser: nach dem Beginn mit dem Paukenwirbel und dem orchestralen Achtel-Ostinato (ein typisches Beispiel für Bruckners innovatorischen Lapidarstil) vor allem die eindringlichen Klangvisionen des „Judicare“, in dem die Bläserfanfaren erstmals noch vor dem jauchzenden „cum gloria“ zum Gottesgericht rufen.
Ein einfaches, letzthin unsignifikantes Motiv erweist sich bei näherer Analyse als einheitsstiftend für die f-Moll-Messe. Gleich zu Beginn wird mit den hier von der Tonika zur Dominante absteigenden vier Tönen das „Kyrie“ angestimmt. Ein Ausdruck visionärer Entrücktheit kommt im „Christe eleison“ durch die aufsteigenden Sechzehntel-Skalen der Violinen in die Musik. Ganz besondere Beachtung aber vierdient jene Stelle, bei der nach dem über einer ostinat kreisenden Bassfigur angesteuerten dynamischen Höhepunkt der Chor a-capella und pianissimo das „Kyrie eleison“ intoniert. Im Finale seiner 2. Symphonie, in deren langsamem Satz das „Benedictus“ der f-Moll-Messe zitiert wird, sollte Bruckner auch auf jene Takte aus dem „Kyrie“ zurückgreifen.
Das überschwänglich jubelnde, im Klagegesang des „Qui tollis“ dann geradezu zerknirschte „Gloria“ krönt Bruckner mit einer 92 Takte langen Schlussfuge („In gloria Dei Patris. Amen.“), deren scharf geschnittenes Thema am Schluss des „Agnus“ noch einmal aufgegriffen wird. Die jahrelangen Studien im „strengen Satz“, nicht zuletzt bei Simon Sechter in Wien, hatten Bruckner dazu befähigt, über die kniffligsten kontrapunktischen Künste in schönster Ungezwungenheit zu schalten.
Felsenfeste Glaubenszuversicht klingt aus dem „Credo in unum Deum“; symbolische Kraft hat hier das Chor-Unisono. Umso wirkungsvoller hebt sich von diesem Al-fresco-Stil in nunmehr lichtem E-Dur das visionäre Tenor-Solo des „Et incarnatus est“ ab. Während in den ersten dreißig Takten des misterioso zu intonierenden Stückes Bässe und Blechbläser schweigen und die Solovioline den Gesang des Tenors meditativ umspielt, greifen leise pulsierende Holzbläserakkorde eine Begleittechnik auf, die nicht zuletzt auf den „Lohengrin“ (Szene im Brautgemach) weist. Die Auseinandersetzung mit dem Werk Wagners und Franz Liszts, dessen Oratorium „legende von der heiligen Elisabeth“ Bruckner tief beeindruckte, hat nicht zuletzt im „Incarnatus“ Spuren hinterlassen. Fugencharakter hat schließlich im Einklang mit fast schon geheiligten Konventionen das abschließende „Et vitam venturi“. Doch die musikalische Form wird hier in Bruckners f-Moll-Messe gleichsam gesprengt, wenn immer wieder bekräftigende „Credo“-Rufe den polyphonen Fluss unterbrechen.
An „Gesangsgruppen“ in den Ecksätzen Brucknerscher Symphonien lässt das kurze „Sanctus“ denken, auf das nach dem „Pleni sunt coeli“ mit dem zum Weihnachtsfest 1867 komponierten „Benedictus“ ein besonders inniger As-Dur Gesang folgt. Das anfangs inständig klagende, gedrückte „Agnus Dei“ schließlich, das bei dem „dona nobis pacem“ das Thema des „Kyrie“ und „Gloria“-Fuge aufgreift, klingt mit der unscheinbaren Tonfolge des bereits erwähnten absteigenden Vier-Noten-Motivs aus. Wie eine Klammer schließt das letztendlich von der Solo-Oboe angestimmte Motiv Anfang und Ende der Messe zusammen.
Mit dem „Te Deum“ und dem 150. Psalm sollte sich Bruckner fortan nur noch zweimal der orchestral begleiteten Musica sacra widmen. Doch unter dem der d-Moll-Messe vorangestellten Signum „O.A.M.D.G.“ („Omnia ad majorem Die gloriam“, Alles zur größeren Ehre Gottes) steht letzthin sein gesamtes Schaffen.
Text: Hans Christoph Worbs im Booklet zur CD von Philips 422358-2 (1989).
Als Solistinnen und Solisten musizieren mit uns: Monika Riedler, Katrin Auzinger, Daniel Johannsen, und Yasushi Hirano
Eine CD dieser Messe wird zum ersten Mal präsentiert! Preis: € 18.-