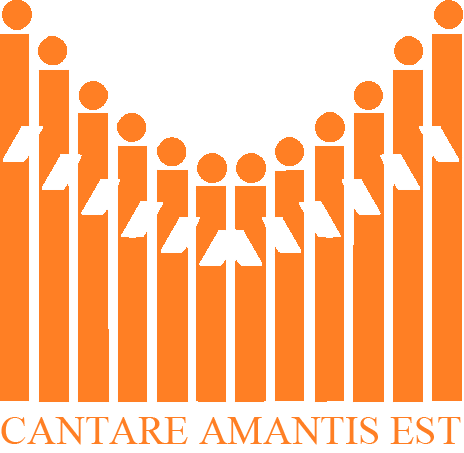NEWSLETTER JÄNNER 2017
Liebe Freunde der Kirchenmusik!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Weihnachtszeit! Vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Gottesdienst mit uns gefeiert; unsere Chorsänger hatten Hochbetrieb, dafür gebührt allen unser großer Dank, es ist ja nicht selbstverständlich, in Zeiten, wo andere Urlaub machen, immer da zu sein, und das alles um Gottes Lohn, denn die Chorsänger werden nicht bezahlt.
Im Jänner präsentieren wir Ihnen die „Heiligen Drei Könige“ der klassischen Wiener Kirchenmusik: Haydn, Mozart und Schubert, wozu ich Sie herzlich einlade. Besonders hervorheben möchte ich Mozarts Dominicusmesse, die seit 3 Jahren nicht mehr aufgeführt wurde. Nützen Sie unbedingt die Gelegenheit, diese große Messe des damals 13-jährigen Wunderkindes zu hören. Zwar ist es in der Jesuitenkirche derzeit ein bisschen kühl, aber warm angezogen ist eine Stunde sicher auszuhalten. Und bedenken Sie, was unsere Instrumentalisten bei dieser Kälte leisten müssen! Trotzdem sind alle mit Freude bei der Sache, um Ihnen schöne Erlebnisse bereiten zu können.
Hartwig Frankl, Obmann
Ich habe soeben die Korrekturlesung dieses Newsletters beendet und bin selbst erstaunt darüber, wie wenig man ihm ansieht, dass er vom Krankenbett aus diktiert wurde. An ein solches ist nämlich unser Obmann seit einigen Wochen gefesselt und befindet sich nach einer sehr ernsten, ja bedrohlichen Situation nun, versehen mit den Gebeten und Fürbitten des Chors und der Gemeinde, auf dem mühevollen Weg der Besserung. Selbst als er noch vor wenigen Tagen kaum mehr sprechen konnte, galten seine größten Sorgen offenbar der Nachbesetzung einer wichtigen Vorstandsposition, Vorbereitung von Plakaten für die Messe (Namen von Solisten mussten geändert werden) Programmfoldern, CD-Booklets und Newslettern der Chorvereinigung, bzw. an der Aufgabenverteilung hierfür.
Erst bei einem solchen unerfreulichen Anlass wie einer Erkrankung merken wir anderen Vorstandsmitglieder, wie unglaublich viel Arbeit – meist nach außen hin unbemerkt – vom Obmann erledigt wird.
Ich glaube auch in Ihrem Namen zu sprechen, wenn ich bei meinem heutigen Besuch im Krankenhaus unserem Obmann Hartwig Frankl alles Gute und eine möglichst rasche vollständige Genesung wünsche.
Martin Filzmaier, Obmann-Stv., am 2. Jänner 2017
Freitag, 6. Jänner 2017, Dreikönigstag:
W.A. Mozart, „Krönungsmesse“, KV 317 (1779)
Unter den in Salzburg entstandenen geistlichen Kompositionen Wolfgang Amadeus Mozarts hat vermutlich keine einen so großen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad erreicht wie die Missa in C, KV 317, für die sich schon im 19. Jahrhundert der Name „Krönungsmesse“ einbürgerte. (Obwohl die Datierung des Autographs auf März 1779 eindeutig auf den Entstehungsanlass der Messe schließen lässt, wird mancherorts noch immer an der erst in unserem Jahrhundert aufgekommenen Legende festgehalten, Mozart habe das Werk für den Jahresfesttag der Krönung des Maria Plainer Gnadenbildes geschaffen, für das Salzburgs berühmteste Wallfahrtskirche im 17. Jahrhundert erbaut worden war.)
Nachdem Mozart im Januar 1779 die sechzehn Monate zuvor voller Erwartung angetretene Reise nach Paris mit der Rückkehr nach Salzburg tief enttäuscht beenden musste und Vater Leopold ihn mit einem bereits abgefassten Gesuch an den Salzburger Erzbischof Hieronymus Graf Colloredo um Dekretierung als Hoforganist empfing, fügte sich Mozart für die folgenden knapp zweieinhalb Jahre dem väterlichen Willen und versah am Salzburger „Bettelhof“ einen Dienst, der sich einerseits auf das geistliche Zentrum, die Domkirche, und andererseits auf die Verpflichtungen bei Hof erstreckte, wobei beide Bereiche auf Repräsentation ausgerichtet und vom Kunstverständnis des Landesfürsten bestimmt waren. Wenn auch keine Dokumente aus diesen Jahren über Vorfälle im Einzelnen Aufschluss geben, in die Mozart involviert gewesen wäre, so lässt sich dennoch aus den brieflichen Äußerungen und Ereignissen, die im Juni 1781 in Wien zum Abschied vom Salzburger Hofdienst führten, die zunehmende Unzufriedenheit Mozarts mit den Salzburger Verhältnissen erahnen. Vor allem des Erzbischofs Gleichgültigkeit, Desinteresse und Unvermögen „mit leuten von talenten um zu gehen“ enttäuschten Mozart und ließen zuletzt sogar wirkliche Abscheu aufkommen, die in den oft zitierten brieflichen Äußerungen ihren Ausdruck fand: „ich will nichts mehr von Salzburg wissen – ich hasse den Erzbischof bis zur raserey.“
Gerade dieser Erzbischof war es jedoch gewesen, der wenige Jahre zuvor, im Januar 1779, Mozarts Wiederanstellung abgesegnet hatte. Im Gegenzug für eine Aufbesserung seines Gehalts um das Dreifache forderte er von Mozart, dass er wie sein Vorgänger „seine aufhabende[n] Verrichtungen sowohl in dem Dom, als bey Hof, und in dem Kapellhauß mit embsigen Fleis ohnklagbar versehe, auch den Hof, und die Kirche nach Möglichkeit mit neuen von Ihm verfertigten Kompositionen bedienne.“ Dieser Verpflichtung dürfte Mozart mit der Messe KV 317 zum erstmöglichen Termin auch nachgekommen sein. Für den 4. April 1779, dem Ostersonntag, an dem der Erzbischof gewöhnlich selbst pontifizierte, präsentierte Mozart seine erste Komposition, die diesen Vertragsbedingungen entsprach. Seine Datierung der autographen Partitur mit „23 di marzo 1779“ deutet darauf hin. Vermutlich hatte Leopold Mozart, dem als Vizekapellmeister in diesen Jahren allein die Leitung der Hofmusik oblag, den Sohn sehr nachdrücklich an dessen Dienstpflichten zu erinnern gewusst.
Die Struktur der Messe entspricht dem vor allem von Erzbischof Hieronymus bevorzugten Typus der „Missa solemnis et brevis“, die sich in ihrer reichen Bläserbesetzung der „Missa solemnis“, in der zeitlichen Ausdehnung aber der „Missa brevis“ annähert. Mozart selbst hat diesen Messtypus in einer brieflichen Mitteilung vom 4. September 1776 an P. Martini sehr präzis beschrieben: „Unsere Kirchenmusik ist von der in Italien sehr verschieden, umso mehr, da eine Messe mit Kyrie, Gloria, Credo, der Epistel-Sonate, dem Offertorium oder Motetto, Sanctus und Agnus Dei, auch an den grössten Festen, wenn der Fürst selbst die Messe liest, nicht länger als höchstens drey Viertelstunden dauern darf. Da braucht man für diese Art Composition ein besonderes Studium, und doch muss es eine Meße mit allen Instrumenten seyn, auch mit Kriegstrompeten!“ Ein weiteres unverkennbares Merkmal dieses Typus von Messkompositionen ist das Fehlen ausgedehnter Schlussfugen zu Gloria und Credo.
Dass Mozart Jahre später bei der Komposition von „Le Nozze di Figaro“ in der Arie der Gräfin „Dove sono i bei momenti“, in der diese die verschwundenen „schönen Augenblicke von Süße und Freude“ beklagt, in einem musikalischen Selbstzitat auf das Agnus Dei der „Krönungsmesse“ zurückgriff, beweist nicht nur, welchen Stellenwert Mozart selbst dieser Komposition zumaß, sondern auch, dass Spannungsfelder zwischen geistlicher und weltlicher Musik wie im 19. Jahrhundert noch nicht bestanden. Für Mozart bildeten die geistliche und weltliche Formensprache weitgehend noch eine Einheit.
Als Solisten hören Sie: Cornelia Horak, Katrin Auzinger, Alexander Kaimbacher und Yasushi Hirano.
Zum Offertorium singt der Chor „Vom Himmel hoch“ von J. S. Bach.
Sonntag, 8. Jänner 2017: Franz Schubert – Messe in B-Dur, D 324
Franz Schubert hat seine dritte Messe in B-Dur im Jahr 1815 geschrieben. Seit einem Jahr war er als „Schulgehilfe“, also als ein untergeordneter Volkschullehrer angestellt. Die Jahre 1815 und 1816 gelten als Schuberts fruchtbarste „Liederjahre“, in denen er mehr Gedichte vertonte als in seinen nach-folgenden Lebensjahren. Es wird wohl immer ein Rätsel bleiben, wie Schubert neben den neun Stunden Dienst als Hilfslehrer mit einer solchen Intensität hatte schreiben können – als ob dieser Zwang den jungen Komponisten erst recht beflügelt hätte. Manchmal entstanden an einem Tag mehrere Lieder, besonders in den Monaten Juli und August 1815 oder etwa am 15. Oktober – allein an diesem Tag vertonte Schubert acht Lieder. Die Kirchenmusik beschäftigte Schubert über seinen gesamten Schaffenszeitraum. Die meisten seiner liturgischen Werke jedoch – die ersten vier lateinischen Messen, mindestens 17 kleinere Stücke und das Fragment eines Requiems – entstanden innerhalb der ersten Schaffensjahre bis zum Jahre 1816, seinem 19. Lebensjahr. Die Kirchenwerke der Jahre 1814 bis 1816 lassen sich durch den Umstand erklären, dass Schubert als Hilfslehrer bei seinem Vater zu den Lichtentaler „Kirchenleuten“ gehörte. In der Zeit bis 1816 wird es Schubert wohl als seine Pflicht angesehen haben, für den Gottesdienst in der Lichtentaler Pfarrkirche zu komponieren, bestand doch über seinen Vater so etwas wie ein Beschäftigungsverhältnis.
Als Solisten wirken mit: Sandra Trattnig, Hermine Haselböck, Gernot Heinrich und Yasushi Hirano.
Offertorium: „Du bist´s dem Ruhm und Ehre„ J.Haydn.
Sonntag, 15.Jänner 2017: W. A. Mozart, „Dominicusmesse“
Mozart komponierte als 13-jähriger die Messe in C-Dur, KV 66 zur Primiz Cajetan Hagenauers, die der spätere Pater Dominicus am 15. Oktober 1769 im Stift St. Peter feierte. Die nach dem Ordensnamen des Familienfreundes benannte „Dominicus-Messe“ ist eine „Missa solemnis“, wie sie zu Hochfesten und besonderen kirchlichen Anlässen aufgeführt wurde. Am 27. Oktober 1769 wurde W.A. Mozart zum unbesoldeten Konzertmeister der fürsterzbischöflichen Hofmusik ernannt. Im Dezember 1769 bricht Leopold Mozart mit seinen beiden Kindern zur ersten Italienreise über Verona, Mailand, Florenz, und Rom bis nach Neapel auf.
Dem Typus nach handelt es sich um eine „feierliche Messe“ mit großer, auch Blechbläser heranziehende Besetzung. Mozart betont diesen solemnen Charakter noch durch eine langsame Einleitung zu Anfang des Kyrie und zwei ausführliche Fugen am Ende von Gloria und Credo. Obwohl Mozart das Werk bereits mit 13 Jahren schrieb, übertrifft es schon einen Großteil der durchschnittlichen kirchlichen Gebrauchsmusik seiner Zeit. Mit großer Liebe ist die Dominicus-Messe KV 66 gestaltet; später, wahrscheinlich 1773, hat Mozart die Bläserbegleitung der Messe um Oboen (alternierend mit Flöten), Hörner und zwei weitere Trompeten erweitert. Im Jahre 1773 wurde diese Messe erstmals in Wien zur Aufführung gebracht.
Cornelia Horak, Martina Steffl, Daniel Johannsen und Markus Volpert wirken als Solisten mit.
Der Chor singt zum Offertorium „Jesus bleibet meine Freude“ von J.S. Bach.
Sonntag, 22. Jänner 2017: Joseph Haydn, „Theresienmesse“
„Seine Andacht“, sagte ein Zeitgenosse, „war nicht von der düsteren, immer büßenden Art, sondern heiter, ausgesöhnt, vertrauend, und in diesem Charakter ist auch seine Kirchenmusik geschrieben.“ Joseph Haydn (1732-1809) wuchs als Chorknabe mit der Kirchenmusik auf – er wurde durch seine liturgische und sängerische Praxis also schon sehr früh in diese Richtung geprägt. Seine Messen, von denen uns insgesamt zwölf erhalten geblieben sind, wurden stets unmittelbar für den kirchlichen Gebrauch geschrieben. Die letzten sechs entstanden zwischen 1796 und 1802, jeweils zum Namenstag von Fürstin Josepha Maria Hermenegild, der Gattin von Haydns Dienstgeber Nikolaus II. Fürst Esterházy.
Bei dem Titel „Theresienmesse“ (Hob.XXII:12) denkt der gelernte Österreicher natürlich sofort an „die“ Kaiserin Maria Theresia, die eigentlich gar keine (gekrönte) Kaiserin war, sondern Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn etc., und eben Gattin und später „Kaiserin-Witwe“ des römisch-deutschen Kaisers Franz I. Stephan. Dass diese Assoziation allerdings zeitlich problematisch ist, ergibt sich aus dem Datum der Uraufführung: Sie fand nämlich am 8. September 1799 statt – und zu diesem Zeitpunkt war Maria Theresia, Tochter Karl VI., bereits fast
19 Jahre tot.
Tatsächlich aber ist die „Theresienmesse“ nach der ersten „richtigen“ österreichischen Kaiserin benannt. Man muss sich im kaiserlichen Stammbaum nicht sehr weit umsehen, um die Widmungsträgerin auszumachen. Dabei handelt es sich um die namensgleiche Enkelin von Maria Theresia und Franz Stephan, Maria Theres(i)a von Neapel-Sizilien, die vermutlich die Sopransolistin der Eisenstädter Uraufführung war. Zu deren Zeitpunkt war die Dame bereits – als Gattin Franz II. seit 1790 – röm.-dt. Kaiserin, ab 1804 dann erste österreichische Kaiserin.
Die örtlichen Gegebenheiten bestimmten oft die Orchestrierung der Kompositionen, und so verweist auch die eingeschränkte Besetzung der „Theresienmesse“ auf die damaligen Aufführungsbedingungen am fürstlichen Hof. Sie gilt deshalb als die lyrischste und intimste der späten Messen Joseph Haydns. Die Messe ist geschrieben für Chor, Soloquartett, Orgel, zwei Klarinetten, zwei Trompeten, Fagott, Streicher und Pauken. Eine Aufführung der Messe dauert ca. 45 min.
Als Solisten wirken mit: Cornelia Horak, Hermine Haselböck, Alexander Kaimbacher und Clemens Sander.
Zum Offertorium singt der Chor „Lobet den Herrn“ von Praetorius.
Bild:
Domenico di Michelino (Florenz, 1417–1491): Die Anbetung der Hl. Drei Könige