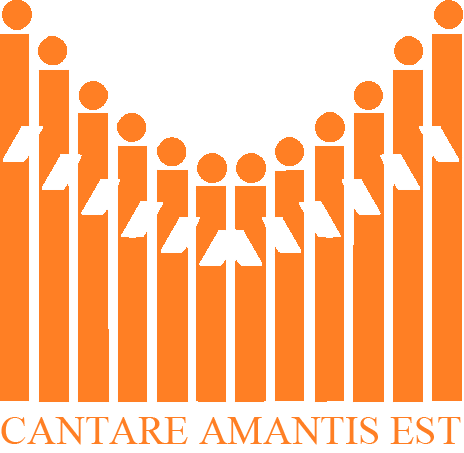Die Fastenzeit ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Während die reine Lehre der Kirchenmusik verlangt, dass in der Advents- und in der Fastenzeit gefälligst keine Messen mit Chor und Orchester aufzuführen sind, sondern a cappella zu singen sei, haben wir das in der Chorvereinigung St. Augustin immer schon ein wenig subversiv aufgeweicht.
Schon in den letzten Jahren wurden viele der Messen zu den Fastensonntagen mit Instrumentalbegleitung gesungen – was übrigens dem historisch richtigen Verständnis von „a cappella“ entspricht: Der Chor singt nicht grundsätzlich ohne Instrumente, aber diese haben dabei keine eigenständige Rolle, sondern begleiten „colla parte“ die Gesangsstimmen. Der Kontrabass bei Michael Haydns a-cappella-Messe (Palmsonntag) geht schon ein wenig über die reine Begleitfunktion hinaus, und die obligaten Bläser in Schuberts Deutscher Messe (6. April) sowieso. Gänzlich durchbrochen wird dieses a-cappella-Prinzip aber bei Michael Haydns wunderbarer „Hieronymusmesse“ (auch „Oboenmesse“ genannt), die wir am letzten Sonntag (30. März) zur allgemeinen Freude der Gemeinde, des Kirchenrektors und aller Mitwirkenden aufführen durften. Das Gloria wurde nicht gesungen – wäre ja noch schöner, in der Fastenzeit, das geht gar nicht! – aber bei der nächsten Aufführung, voraussichtlich im Herbst, singen wir das Werk komplett, ich versprech’s!
Der tiefere Sinn der kirchenmusikalischen Änderungen in der Fastenzeit gegenüber dem Gewohnten („mit Pauken und Trompeten“) ist uns aus der Politik – dort zumindest als Schlagwort – gut bekannt: kein Weiter wie bisher! Wir verzichten auf einiges (symphonische Orchesterbesetzung, Solisten – zumindest meistens) und geben der Besinnung und der Einkehr (eigentlich: der Umkehr, dem Umdenken: μετάνοια) größeren Raum.
Gänzlich abhandengekommen sind der Chorvereinigung Werke wie die Johannespassion von Schütz, die wir anno dazumals, zu St.-Augustin-Zeiten, regelmäßig am Karfreitag gesungen haben. Auch Bachs Johannespassion stünde eine Wiederaufnahme gut an. Mit weiterhin zunehmender Chorgröße und -stabilität wird das für die Zukunft durchaus zu überlegen sein.
Den Jubel des Ostersonntags überlassen wir unserem Partnerchor und Herrn Franz Joseph Haydn, stimmen dann aber am Weißen Sonntag mit der „Credomesse“ von Wolfgang Amadé M. mit ein.
Zu Herrn Haydn und zu dessen „Schöpfung“ schreibe ich erst im nächsten Newsletter etwas. In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen Allen namens der Chorvereinigung St. Augustin eine gute Fastenzeit ohne das „Weiter wie bisher“ und dann ein frohes Osterfest!
Martin Filzmaier, Obmann
Sonntag, 6. April 2025, 10:30 Uhr: Franz SCHUBERT – „Deutsche Messe“ D 872
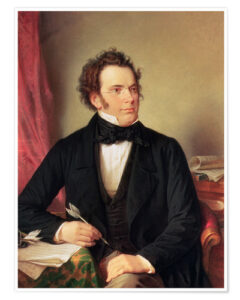 Die ersten zwei Takte des Eingangsliedes „Wohin soll ich mich wenden“ entsprechen übrigens exakt dem Beginn des Eingangschors „Das holde Licht des Tages“ aus Schuberts Opernfragment „Sakuntala“ D 701 aus dem Jahr 1820; es handelt sich hier um eine Reminiszenz an Neumann, der auch der Librettist dieser Oper war.
Die ersten zwei Takte des Eingangsliedes „Wohin soll ich mich wenden“ entsprechen übrigens exakt dem Beginn des Eingangschors „Das holde Licht des Tages“ aus Schuberts Opernfragment „Sakuntala“ D 701 aus dem Jahr 1820; es handelt sich hier um eine Reminiszenz an Neumann, der auch der Librettist dieser Oper war.
Die Resonanz der Zeitgenossen lässt sich gut aus einem Bericht der Wiener Allgemeinen Musikzeitung über eine Aufführung des Kirchenmusikvereins bei St. Anna am 8. Dezember 1845 (dem Fest Mariae Empfängnis) unter der Leitung von Ferdinand Schubert, dem Bruder des Komponisten, entnehmen. Bei dieser Aufführung „mit Begleitung von 2 Oboen und 3 Posaunen in Vertretung der Orgel“ war die Vater-unser-Paraphrase des Anhanges („Anbetend deine Macht und Größe versinkt in Nichts mein betend Ich…“) als Offertorium eingeschoben worden:
„[…] einfach, erhaben und festlich selbst für den ungebildeten Laien; das „Vaterunser“ gehört wirklich zu dem Gelungensten, was in diesem Genre geschrieben wurde. Kraft und Vertrauen gepaart mit einem kindlich frommen Sinn […] dieses Kirchenliedes“.
Im Zuge der Popularisierung wurde die Schubert’sche Komposition häufig und nicht immer qualitätsvoll bearbeitet. Auch von Josef Gruber, dem Komponisten des Stille Nacht, Heilige Nacht existiert eine Bearbeitung. Einer der wichtigsten Bearbeiter der ersten Jahrzehnte nach Schuberts Tod war jedoch Ferdinand Schubert selbst. Er nahm u.a. den Text des sechsten Teils Nach der Wandlung („Betrachtend deine Huld und Güte“) und unterlegte ihn 1851 dem Gebet des Herrn („Anbetend deine Macht und Größe…“) im Anhang. Aus diesem Grund war der sechste Teil einige Zeit aus vielen populären Bearbeitungen verschwunden. Die Melodie dieses sechsten Teils ist übrigens bis auf die ersten fünf Noten identisch mit Schuberts Pax vobiscum („Der Friede sei mit euch“) D551 aus dem Jahre 1817. Bereits diese textliche Umarbeitung kann man als Verfälschung der ursprünglichen Absichten des Komponisten betrachten, da der wuchtige Satz des Anhangs eben der erschütternden Größe Gottes („Macht und Größe)“ zugedacht war und mit dem sanften Text des sechsten Teils („Huld und Güte“) wenig harmoniert.
Bereits 1845 war der Anhang, das Gebet des Herrn bei dem Wiener Verleger Karl Haslinger in Druck erschienen. 1854 bot Ferdinand Schubert Haslinger eine Fassung des „Deutschen Hochamtes“ für Männerchor an, und im selben Jahr erschien in Wien auch eine sehr entstellte Bearbeitung von Josef Ferdinand Kloß in einem „Lehrbuch der Kirchenmusik“. 1855 folgen, ebenfalls von Kloß redigiert und durch einen Ministerialen Erlass unterstützt, die Vierstimmigen Kirchengesänge für Studierende an Oesterreichischen Realschulen mit vielen Änderungen im Satz, nun auch geeignet „für den orgelbegleiteten einstimmigen Massengesang“. Der „Österreichische Schulbote“, eine Fachzeitschrift für die Lehrerschaft bezeichnet Schuberts „Messe“ auf Basis dieser Bearbeitung als „einen Liederkreis, welcher allein dem von M. Haydn [Anm.: Gemeint ist Haydns Deutsche Messe „Hier liegt vor deiner Majestät“] ebenbürtig an die Seite gestellt werden kann und die größte Verbreitung verdient“. Diese Ausgabe erschien noch 1911 in 16. Auflage. 1866 publizierte Johann Ritter von Herbeck (Hofkapellmeister, Hofoperndirektor, Professor am Konservatorium des Vereines der Musikfreunde und Förderer der Aufführung Schubert’scher Werke) eine a cappella-Fassung für Männerchor bei C. Spina in Wien. Entgegen einer auch heute noch weitverbreiteten Meinung gibt es keine authentische Fassung für Männerchor, es handelt sich dabei ausschließlich um Bearbeitungen von fremder Hand. Nichtsdestoweniger erfreuten sich gerade im ausgehenden 19. Jh. diese Männerchorbearbeitungen einer hohen Beliebtheit. Die dabei zu beobachtenden Verfälschungen und Entstellungen in Satz und Stimmführung wurden im Sinne des herrschenden Zeitgeistes jedoch eher als „Verbesserung“ gesehen und auch das Weglassen der Instrumentalbegleitung ist aus der Überzeugung der Zeitgenossen abzuleiten, dass das höchste Ideal der Kirchenmusik der unbegleitet a cappella-Gesang sei. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Aufführung der Deutsche Messe von Schubert heute gerade deswegen zum Teil auf Vorbehalte trifft, weil die zahllosen Bearbeitungen zu einer nicht unerheblichen Verkitschung beigetragen haben. Ein weiterer Grund sind die heute sicherlich nicht mehr ganz zeitgemäßen Texte, aber es wäre schade, wenn dies der wunderbaren Musik Schuberts Abbruch täte.
(Kirchenmusik in Benediktbeuern)
Palmsonntag, 13. April 2025, 10:30 Uhr:
Michael HAYDN – Missa Quadragesimalis MH 57/MH 552 (1762/1794)
früher „Missa Dolorum Beatissimae Virginis Mariae“ genannt
 Michael Haydn war ein wichtiger Wegbereiter der geistlichen Musik. Bekannt sind seine geistlichen Chorwerke, Außerdem gilt Michael Haydn als maßgeblicher Begründer des Männerchores und des vierstimmigen Gesanges. Er war auch ein fruchtbarer Komponist weltlicher Musik. Unter anderem schuf er 40 Sinfonien und 32 Messen, einige Instrumentalkonzerte und Kammermusik. Eine Begründung, warum Michael Haydn weit weniger bekannt ist als sein berühmter Bruder Joseph, mag darin liegen, dass seine Werke zu seiner Lebzeit nicht verlegt wurden, sondern lediglich in handschriftlichen Kopien hauptsächlich von Kloster zu Kloster, hier vor allem natürlich seine geistlichen Werke, verbreitet wurden. In Salzburg wirkte Michael Haydn 43 Jahre lang bis zu seinem Tod. Er war ein Freund Mozarts, wobei beide Musiker einander sehr schätzten. Besondere Beachtung fand sein Requiem in c-Moll, zweifellos auch ein Vorbild für W.A. Mozart. Ein Großteil des Schaffens von Michael Haydn ist der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt und harrt noch seiner Entdeckung.
Michael Haydn war ein wichtiger Wegbereiter der geistlichen Musik. Bekannt sind seine geistlichen Chorwerke, Außerdem gilt Michael Haydn als maßgeblicher Begründer des Männerchores und des vierstimmigen Gesanges. Er war auch ein fruchtbarer Komponist weltlicher Musik. Unter anderem schuf er 40 Sinfonien und 32 Messen, einige Instrumentalkonzerte und Kammermusik. Eine Begründung, warum Michael Haydn weit weniger bekannt ist als sein berühmter Bruder Joseph, mag darin liegen, dass seine Werke zu seiner Lebzeit nicht verlegt wurden, sondern lediglich in handschriftlichen Kopien hauptsächlich von Kloster zu Kloster, hier vor allem natürlich seine geistlichen Werke, verbreitet wurden. In Salzburg wirkte Michael Haydn 43 Jahre lang bis zu seinem Tod. Er war ein Freund Mozarts, wobei beide Musiker einander sehr schätzten. Besondere Beachtung fand sein Requiem in c-Moll, zweifellos auch ein Vorbild für W.A. Mozart. Ein Großteil des Schaffens von Michael Haydn ist der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt und harrt noch seiner Entdeckung.
Die Missa Quadragesimalis MH 552 wurde am 6. März 1794 fertiggestellt. Es handelt sich bei dieser Messe nicht um eine Neukomposition, sondern um eine wiederverwendete Version der Missa Dolorum Beatissimae Virginis Mariae, die Haydn 1762 in Großwardein komponiert hatte und für die uns keine Quellen überliefert sind. Trotzdem entspricht sie in der Sparsamkeit der Mittel und dem ausgesprochen homophonen Stil den Werken, die unter dem Einfluss der liturgischen Reform in Salzburg in den 1790er Jahren entstanden. Von allen Quadragesma-Messen Haydns greift die Missa Quadragesimalis am wenigsten auf den gregorianischen Choral zur Bildung von melodischem Material zurück. Nur das kurze „Et incarnatus est“ zitiert einen „Chorale“, wobei sich dieser Choral nicht in einem modernen Choralbuch nachweisen ließ.
Die autographe Partitur befindet sich in der Musiksammlung der Bayerischen Staatsbibliothek München, Stimmen in Haydns eigener Handschrift sind im Archiv der Benediktinerabtei St. Peter aufbewahrt und sind beschrieben mit: „Missa Quadragesimalis.á 4 voci in pino, col’Organo. Di Giov: Michele Haydn. Ad Chorum Monasterii S. Petrens, Salzburgi.“ Der Stimmensatz besteht aus den Stimmen Canto, Alto, Tenore, Basso, Violone und Organo.
Aus dem Vorwort von Charles H. Sterman in der Partitur der Carus-Ausgabe 1995.
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „O Haupt voll Blut und Wunden“ von J.S.Bach.
Sonntag, 27. April 2025, 10:30 Uhr: W. A. MOZART – Große Credomesse KV257
 Die Große Credo-Messe, datiert auf November 1776, erklang zur Bischofsweihe des Grafen von Spaur im Salzburger Dom. Dem Umfang nach steht sie zwischen Missa brevis und Missa longa. Auch formal gesehen ist sie eine Mischung aus beiden Gattungen. Mozart verzichtet gänzlich auf Fugenkomposition. Andererseits ist das Credo in einem großen sinfonischen Satz angelegt. Der mit dem Stil eines Opera-buffa-Finales vergleichbare Schlussteil stellt ebenso wie die stringente Verbindung einzelner Sätze eine Neuerung dar.
Die Große Credo-Messe, datiert auf November 1776, erklang zur Bischofsweihe des Grafen von Spaur im Salzburger Dom. Dem Umfang nach steht sie zwischen Missa brevis und Missa longa. Auch formal gesehen ist sie eine Mischung aus beiden Gattungen. Mozart verzichtet gänzlich auf Fugenkomposition. Andererseits ist das Credo in einem großen sinfonischen Satz angelegt. Der mit dem Stil eines Opera-buffa-Finales vergleichbare Schlussteil stellt ebenso wie die stringente Verbindung einzelner Sätze eine Neuerung dar.
Die Bezeichnung „Credomesse“ bezieht sich auf den ausgedehnten Credosatz, der den inneren Höhepunkt, der Menschwerdung und Kreuzigung Christi, darstellt. Immer wieder wird der Ruf „credo, credo“ als etwas sehr Zentrales in unserem christlichen Glauben in den Mittelpunkt gestellt.
Mozart greift hier wie in seiner früheren „Kleinen Credomesse“ KV 192 eine kirchenmusikalische Praxis auf, die seit Beginn des 18. Jahrhunderts in Süddeutschland und Österreich nachgewiesen ist. Die mehrfache Wiederholung der Anfangsworte des „Credo“ setzte voraus, dass die Vertonung der Intonation „Credo in unum Deum“ liturgisch überhaupt toleriert wurde. Konnte man die sonst vom Zelebranten allein vorgetragene Intonation in die mehrstimmige Komposition einbeziehen, so war es nur ein kleiner und syntaktisch logischer Schritt, das „Credo“ vor den einzelnen Glaubensartikeln zu wiederholen und damit das Glaubenszeugnis zu bekräftigen.
(Text aus dem Internet, Quelle unbekannt)
Als Solisten wirken mit: Cornelia Horak, Eva Maria Riedl, Franz Gürtelschmied und Stefan Zenkl.
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ von Melchior Vulpius (1570-1615).