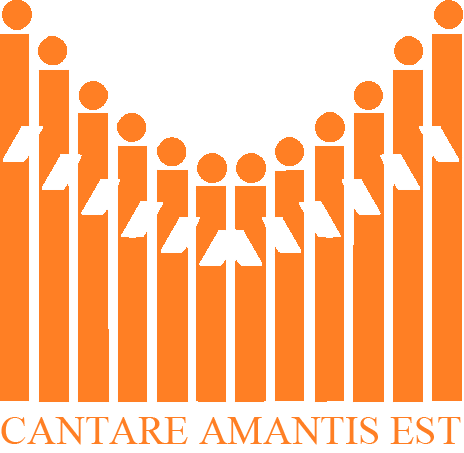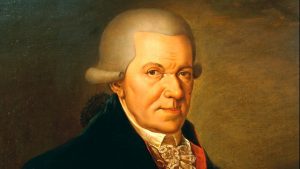Nach Schuberts Messe in B zu Anfang des Monats leiten wir die in diesem Jahr sehr spät beginnende Fastenzeit mit Rheinberger ein. Traditionell ist die Fastenzeit eine für den Chor ruhigere Zeit, wo oftmals schon für kommende Konzerte geprobt wird. – So auch diesmal; denn „Die Schöpfung“ haben wir zuletzt vor 11 Jahren gesungen. Das braucht dann immer etwas Zeit für die Wiedereinstudierung. Der Kartenverkauf für das Konzert am MITTWOCH, dem 14. Mai (bitte beachten Sie den Fehler im Folder: Freitag ist falsch) läuft jedenfalls bereits, und der Chormanager freut sich auf und über viele Kartenbestellungen.
Viele unserer Besucher schätzen auch die Zeit „ohne Pauken und Trompeten“, denn wir singen in der Fastenzeit (meistens) ohne Orchesterbegleitung. Am 3. Fastensonntag, dem 23. März, singen wir gar keine auskomponierte Messe, sondern „kommentieren“ die Liturgie mit ausgewählten Motetten.
Am 4. Fastensonntag, „Laetare“, freuen wir uns aber doch über ein wenig Begleitung. Michael Haydns „Missa Sancti Hieronymi“ verlangt eine bläserlastige Orchesterbesetzung. Die Messe „hat es in sich“, ist also durchaus herausfordernd – anders, als wir es von den schlichteren a-cappella-Messen des Komponisten gewohnt sind – und wird nach dieser erst 2. Aufführung bei uns einen festen Platz im Repertoire einnehmen.
Martin Filzmaier
Sonntag, 2. März 2025, 10:30 Uhr: Franz SCHUBERT – Messe in B-Dur, D 324 (1815)
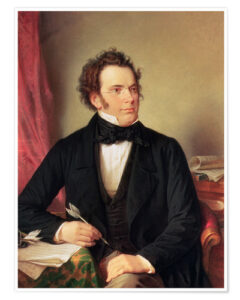 Nur acht Monate nach der Komposition der G-Dur-Messe begann Schubert am 11. November 1815 seine 3. Messe, diejenige in B-Dur D 324. Sie ist gesetzt für Chor und Solistenquartett SABT, zwei Violinen, Viola, je zwei Oboen, Fagotte und Trompeten, Pauken und einem aus Violoncello, Kontrabass und Orgel bestehendem Continuo. Obwohl die B-Dur-Messe mit einer Aufführungsdauer von etwa 30 Minuten durchaus noch als Missa brevis bezeichnet werden kann, weist sie diese große Besetzung als Werk für eine besondere Gelegenheit aus. Sie knüpft in dieser Hinsicht an der Messe in F-Dur, D 105 an, wenn auch in einem etwas kleineren Maßstab, was die Dauer betrifft. Obwohl als sicher angenommen werden kann, dass sie in Lichtental zur Aufführung kam, ist der genaue Anlass ebenso unbekannt wie das Datum, an dem die Komposition beendet wurde. Die autographe Partitur, die sich heute in British Library in London befindet, enthält einige spätere Korrekturen, die wohl im Zusammenhang mit einer Aufführung gemacht wurden. Sie scheint wohl auch außerhalb Wiens bekannt gewesen zu sein: Ferdinand Schubert berichtet in einem Brief an seinen Bruder Franz vom 6. Oktober 1824 von einer Aufführung einer Messe eines unbekannten Komponisten in Hainburg (zwischen Wien und Bratislava), zu der er gebeten wurde, die Orgel zu spielen. Als er die Noten erhielt, erkannte er in dem Werk die B-Dur-Messe des Brief-Adressaten. Die Aufführung selbst lobt er in den höchsten Tönen, nur der Tenor wäre „etwas ängstlich und stimmlich schwach“ gewesen… Das Répertoire International des Sources Musicales weist etwa ein halbes Dutzend Abschriften aus Österreich, Deutschland und Tschechien aus. Ihre Verbreitung war jedoch bei weitem nicht die der anderen drei Lichtentaler Messen in F-Dur, G-Dur und C-Dur. Auch heute noch scheint es die am wenigsten häufig aufgeführte Messe dieser Reihe zu sein. Der Erstdruck erfolgte jedoch bereits 1837 bei Haslinger in Wien.
Nur acht Monate nach der Komposition der G-Dur-Messe begann Schubert am 11. November 1815 seine 3. Messe, diejenige in B-Dur D 324. Sie ist gesetzt für Chor und Solistenquartett SABT, zwei Violinen, Viola, je zwei Oboen, Fagotte und Trompeten, Pauken und einem aus Violoncello, Kontrabass und Orgel bestehendem Continuo. Obwohl die B-Dur-Messe mit einer Aufführungsdauer von etwa 30 Minuten durchaus noch als Missa brevis bezeichnet werden kann, weist sie diese große Besetzung als Werk für eine besondere Gelegenheit aus. Sie knüpft in dieser Hinsicht an der Messe in F-Dur, D 105 an, wenn auch in einem etwas kleineren Maßstab, was die Dauer betrifft. Obwohl als sicher angenommen werden kann, dass sie in Lichtental zur Aufführung kam, ist der genaue Anlass ebenso unbekannt wie das Datum, an dem die Komposition beendet wurde. Die autographe Partitur, die sich heute in British Library in London befindet, enthält einige spätere Korrekturen, die wohl im Zusammenhang mit einer Aufführung gemacht wurden. Sie scheint wohl auch außerhalb Wiens bekannt gewesen zu sein: Ferdinand Schubert berichtet in einem Brief an seinen Bruder Franz vom 6. Oktober 1824 von einer Aufführung einer Messe eines unbekannten Komponisten in Hainburg (zwischen Wien und Bratislava), zu der er gebeten wurde, die Orgel zu spielen. Als er die Noten erhielt, erkannte er in dem Werk die B-Dur-Messe des Brief-Adressaten. Die Aufführung selbst lobt er in den höchsten Tönen, nur der Tenor wäre „etwas ängstlich und stimmlich schwach“ gewesen… Das Répertoire International des Sources Musicales weist etwa ein halbes Dutzend Abschriften aus Österreich, Deutschland und Tschechien aus. Ihre Verbreitung war jedoch bei weitem nicht die der anderen drei Lichtentaler Messen in F-Dur, G-Dur und C-Dur. Auch heute noch scheint es die am wenigsten häufig aufgeführte Messe dieser Reihe zu sein. Der Erstdruck erfolgte jedoch bereits 1837 bei Haslinger in Wien.
(Text: Kirchenmusik in Benediktbeuern)
Es musizieren mit uns die Solisten Cornelia Horak, Martina Steffl, Daniel Johannsen und Klemens Sander.
Diese Messe ist auf CD erhältlich.
Sonntag, 9. März 2025, 10:30 Uhr: J. G. RHEINBERGER: „Missa St.ae Crucis“, Messe in G-Dur op. 151 (1882)
Der 1839 in Vaduz geborene Josef Gabriel Rheinberger zeigte schon früh ungewöhnliche Musikalität. Er versah bereits als Siebenjähriger den Organistendienst in seinem Heimatort. Nach erstem Musikunterricht 1844 in Vaduz und 1849 in Feldkirch/Österreich zog Rheinberger mit 12 Jahren in die Wahlheimat München und besuchte dort bis 1854 das Münchner Konservatorium, wo er seine Kommilitonen bald überflügelte und bereits zahlreiche Werke schuf. Als er 19 Jahre alt war, bot ihm das Konservatorium eine Dozentur für Klavier, 1860 für Harmonielehre, Kontrapunkt und Musikgeschichte an, die er bis kurz vor seinem Lebensende ausübte. 1853 bis 1867 war er Organist an verschiedenen Münchener Kirchen. Er war als Kompositionslehrer am Münchner Konservatorium eine Kapazität von internationalem Rang. Zu seinen Schülern zählten unter vielen anderen Engelbert Humperdinck, Ermanno Wolf-Ferrari und Wilhelm Furtwängler sowie eine ganze Generation junger US-amerikanischer Komponisten.
Rheinberger gehörte zu den erfolgreichen Komponisten seiner Zeit, an den Verleger, Musiker und Chöre mit Kompositionsaufträgen herantraten. Als Hofkapellmeister des bayerischen Königs Ludwigs II. nahm er eine zentrale Position innerhalb der katholischen Kirchenmusik in Deutschland ein. Er komponierte lateinische Messen und Motetten, die in ihrer Unabhängigkeit von den einengenden Vorschriften der cäcilianischen Kirchenmusikreformer seiner Zeit wegweisend waren. Die meisten Sakralwerke entstanden in Rheinbergers letzter Schaffensphase.
Rheinberger wurde in München bestattet. Nach Zerstörung der Grabstätte im Zweiten Weltkrieg wurden die Gebeine von Rheinberger und seiner Gattin 1949 nach Vaduz überführt und in einem Ehrengrab auf dem Friedhof der Pfarrei St. Florin beigesetzt.
Rheinberger komponierte die Missa St.ae Crucis op. 151 im September 1882 während eines Sommerurlaubs in Wildbad Kreuth. Sie enthält einprägsame, wunderschöne Motive und vermeidet extreme Stimmlagen. Die einzelnen Sätze sind harmonisch reich gestaltet, mit viel Sinn für Klang und mit den für Rheinberger typischen überraschenden Modulationen. Der Beiname der Messe ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Rheinberger die Komposition 1883 selbst erstmals in der Karwoche in der Allerheiligen Hofkapelle in München zur Aufführung brachte. Später führte er die „Missa in G-Dur“, wie sie auch schlicht genannt wird, auch außerhalb der Fastenzeit auf. Wie alle Werke dieses international nicht überaus bekannten Komponisten, bringt die Missa St.ae Crucis starke Emotionen im Dienste der Liturgie zum spannenden Ausdruck.
(Text aus dem Internet, Autor unbekannt)
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Vexilla regis“ von Anton Bruckner (WAB 51)
„Ich habe es nach reinem Herzensdrange komponiert”, schrieb Bruckner über seine 1892 entstandene letzte kleine Kirchenkomposition.
Vexilla regis prodeunt fulget crucis mysterium quo carne carnis conditor suspens est patibulo.
Des Königs Fahnen ziehen voran, hell erstrahlt das Geheimnis des Kreuzes, an dessen Holz der Schöpfer des Fleisches im Fleische aufgehängt ist.
O crux ave spes unica hoc passionis tempore auge piis justitiam reisque dona veniam.
O Kreuz, sei gegrüßt, einzige Hoffnung in dieser Leidenszeit! Mehre den Frommen Gerechtigkeit, den Sündern schenke Verzeihung.
Te summa Deus Trinitas collaudet omnis spiritus quos per crucis mysterium salvas per saecula. Amen.
Dich, Gott, höchste Dreieinigkeit, lobe jeder Geist. Die du durch das Geheimnis des Kreuzes erlöst, regiere in Ewigkeit. Amen.
Sonntag, 23. März 2025, 10:30 Uhr
MOTETTEN zur Fastenzeit:
Mit thematisch nur in die Fastenzeit, bzw. die Karwoche passenden Motetten tritt die Chorvereinigung St. Augustin ein wenig aus der „üblichen“ Gestaltung der Sonntagshochämter heraus. Anders als die vertonten Messtexte der klassischen Messkompositionen vertiefen diese Motetten auf besonders eindringliche Weise spezielle Themen der 40 Tage vor Ostern.
Zum Einzug:
Heinrich SCHÜTZ (1585-1672): Ehre sei dir Christe
Nach der Lesung:
Georgius BARDOS (1905-1991): Eli, Eli
Gabenbereitung:
Melchior FRANK (1579-1639): „Fürwahr, er trug unsre Krankheit“
Vater unser:
Igor STRAWINSKY (1882-1971): Pater noster
Danklied (Auszug):
Heinrich SCHÜTZ (1585-1672): Also hat Gott die Welt geliebt
Sonntag, 30. März 2025, 10:30 Uhr
Michael HAYDN – „Oboenmesse“, Missa Sancti Hieronymi MH 254 (1777)
Mit 40 Messen, zwei Requien, sechs Te Deum-Vertonungen, 117 Gradualien, 45 Offertorien, Responsorien für Weihnachten und die Karwoche sowie zahlreichen weiteren kirchenmusikalischen Schöpfungen war Michael Haydn (1737-1806) vermutlich der am weitesten beachtete Kirchenkomponist zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Die Brüder Joseph und Michael Haydn, machten eine sehr unterschiedliche Karriere und ihre Musik ist auch heute noch keinesfalls gleichermaßen verbreitet. Der musikalische Weg der beiden Brüder verlief zunächst noch recht ähnlich: Beide erhielten ihre erste Ausbildung in Hainburg und gingen später nach Wien, wo sie zunächst Chorknaben an St. Stephan wurden und ihre musikalische Ausbildung erhielten. Trotz des Altersunterschieds von fünf Jahren verbrachten sie einige Jahre gemeinsam im Wiener Kapellhaus, bevor sich ihre beruflichen Wege trennten und in sehr unterschiedlichen Richtungen verliefen: Joseph Haydn machte Karriere in Esterháza und unternahm von dort aus sehr erfolgreichen Reisen innerhalb Europas. Sein jüngerer Bruder Michael hingegen ging nach Salzburg an die Hofkapelle, wo er sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitete, der sich aber weitestgehend auf Salzburg beschränkte. Und doch: Später sollte ihn sogar der 20 Jahre jüngere Wolfgang Amadeus Mozart bewundern. Tatsächlich waren diese beiden unterschiedlichen Lebenswege und Karrieren in erster Linie die Folge bewusster Entscheidungen, denn auch Michael Haydn fühlte sich in seiner lebenslangen Stellung in Salzburg durchaus sehr wohl und hatte auch gar kein Interesse an einem Fortkommen.
Ab 1763 in Salzburg tätig, galt der erzbischöfliche „Hofmusicus und Conzertmeister“ (nicht nur) in amtskirchlichen Kreisen als bedeutendster Vertreter wahrer Kirchenmusik, der – so das Salzburger Diözesanblatt vom 13. Mai 1809 – „an Stelle des unedlen Geschmackes den ächten Kirchenstyl einführte“. Der also – getreu der Enzyklika „Annus qui“ von Benedikt XIV. aus dem Jahr 1749 – den Säkularisierungstendenzen innerhalb der Musik für den Gottesdienst widerstand. Deutlich erkennbar ist die Distanzierung Michael Haydns von der opernhaften Kirchenmusik und den Elementen des „Theaterstils“ in seinen für die Karwoche des Jahres 1778 geschriebenen Responsorien Responsoria pro Hebdomada Sancta (MH 276, 277, 278).
Der jüngere Bruder des berühmten Joseph Haydn war als Hofmusiker, Konzertmeister und Domorganist in Salzburg längst ein Star, vor Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Missa Sancti Hieronymi, wegen ihrer Besetzung mit 6 Oboen auch „Oboenmesse“ genannt, und die Einlage dazu, das Timete Dominum, wurden 1777 im Salzburger Dom uraufgeführt.
(Text: Christof Jetzschke auf der CD Hungaroton HCD 32596)
Solisten sind: Cornelia Horak, Eva Maria Riedl, Alexander Kaimbacher, Markus Volpert.
Zum Offertorium singt der Chor: J. S. Bach – Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38,
Bach komponierte die Choralkantate 1724 in Leipzig für den 21. Sonntag nach Trinitatis und führte sie am 29. Oktober 1724 erstmals auf. Die Kantate basiert in Text und Melodie auf dem Kirchenlied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, in dem Martin Luther den Psalm 130 nachdichtete.
Bach komponierte die Kantate in Leipzig 1724 als Teil seines zweiten Kantatenzyklus für alle Anlässe des Kirchenjahres, den er als Zyklus von Choralkantaten plante, basierend auf den Liedern, die von der lutherischen Kirche den Anlässen zugeordnet waren. Er begann den Zyklus mit dem ersten Sonntag nach Trinitatis und schrieb diese Kantate für den 21. Sonntag nach Trinitatis.
Die Kantate basiert auf Text und Melodie von Luthers Bußlied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, einer Umdichtung von Psalm 130. Es war zu Bachs Zeit ein Hauptlied für den Sonntag. Der Liedtext der ersten und letzten Liedstrophe ist unverändert und wurde von Bach wie üblich als eine eröffnende Choralfantasie und vierstimmiger Schlusschor gestaltet. Ein unbekannter Textdichter formulierte die übrigen drei Strophen um zu vier Sätzen, abwechselnd Rezitativ und Arie. Bach leitete die erste Aufführung der Kantate am 29. Oktober 1724.