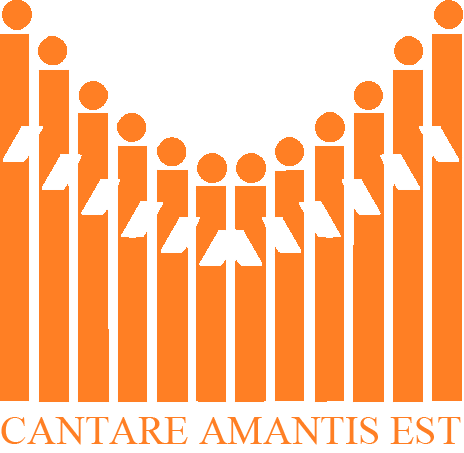Liebe mit der Kirchenmusik – und mit der Chorvereinigung – Verbundene!
Es ist ganz einfach, ein gut funktionierendes System zu kippen – und sehr, sehr mühsam und langwierig, es wiederherzustellen.
Die großen Messen kommen jetzt Schritt für Schritt zurück. Wir sangen am 1. Oktober die Dvořák-Messe, am 24. folgt unser erstes Konzert seit 2020, im November Haydns Heiligmesse und zum Abschluss des Kirchenjahres endlich auch wieder Schuberts Große Messe in Es; durchaus herausfordernde Werke, wo der Chor schon einiges zu tun hat. – Bis auf weiteres zurückstellen mussten wir allerdings noch die Gestaltung der Offertorien – meist Motetten, die a cappella gesungen werden. Das ist jetzt weniger ein Problem für die Liturgie (s. d. letzten Absatz des Artikels zur „Kleinen Credomesse“ weiter unten), als für das Selbstverständnis der Chorvereinigung. In unserer jahrzehntelangen Geschichte waren Festtage wie Allerheiligen immer verbunden mit Salieris Motette „Justorum Animae“, oder – wiewohl die letzte Aufführung viele Jahre zurückliegt – Heillers „Dem König aller Zeiten“ zum Christkönigsfest, zumal Anton Heiller am 15. September seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte; auch sein „Justus ut palma florebit“ war einst fixer Bestandteil unseres Repertoires. All das wird noch ein wenig auf sich warten lassen…
Daher müssen wir Sie und auch uns selber noch um Geduld bitten für den Weg, den wir bis zur alten Stärke noch vor uns haben. Mozarts Requiem war das Programm unseres letzten Konzerts in der Pandemie, fast genau 3 Jahre vor dem nun angesetzten Konzert mit demselben Programm. Damals wähnten wir uns durch Anwendung zu der Zeit bekannter Schutzmaßnahmen in Sicherheit – die Folgen waren dramatisch. Dieses Mal werden – bei durchaus vergleichbarer Infektionsgefahr, aber unter gänzlich anderen Voraussetzungen – keine besonderen Maßnahmen ergriffen. Wer sich Ende Oktober unvermeidlich im öffentlichen Raum aufhält oder gar in einem Chor singt, nimmt ein Restrisiko in Kauf, sich eine Erkältung einzuhandeln. Das war aber schon immer so. Für die allermeisten Menschen ist CoViD-19 zu einer von vielen anderen lästigen, unangenehmen Erkältungskrankheiten geworden, und wir veranstalten unser Konzert, das diesmal wieder von P. Gustav Schörghofer eingeleitet wird, ohne Bedenken und mit großer Vorfreude. – Sie sind herzlich willkommen!
Martin Filzmaier
Sonntag, 8. Oktober 2023: W.A.MOZART – „Orgelsolomesse“ KV 259 (1776)
 W.A.Mozarts Orgelsolomesse KV 259 gehört zu den Messen, die er in seiner Salzburger Zeit ab 1772 im Dienst des Fürstbischofs Colloredo komponierte. Dieser hatte verfügt, dass ein Hochamt mit Messkomposition nicht länger als eine dreiviertel Stunde dauern dürfe. So musste Mozart sich in seiner Musiksprache konzentrieren, um den gesamten Ordinariumstext (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei) in einer Missa brevis (kurze Messe) unterzubringen. Die Orgelsolomesse KV 259 ist die kürzeste Messe Mozarts; der liturgische Text ist straff durchkomponiert, Wortwiederholungen zur Steigerung der Wirkung sind selten. Das Kyrie ist mit 29 Takten das kürzeste, das Mozart jemals schrieb. Im Credo führt die Kürze zu diffuser Polytextur. Das Benedictus, nachträglich um insgesamt 18 Takte gekürzt, zeichnet sich durch den solistischen Orgelpart aus, der in den vierstimmigen Vokalsatz in konzertähnlicher Form eingearbeitet ist. Der erste Teil des Agnus Dei wirkt mit seiner pizzicato begleiteten Violinmelodie wie eine Serenade.
W.A.Mozarts Orgelsolomesse KV 259 gehört zu den Messen, die er in seiner Salzburger Zeit ab 1772 im Dienst des Fürstbischofs Colloredo komponierte. Dieser hatte verfügt, dass ein Hochamt mit Messkomposition nicht länger als eine dreiviertel Stunde dauern dürfe. So musste Mozart sich in seiner Musiksprache konzentrieren, um den gesamten Ordinariumstext (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei) in einer Missa brevis (kurze Messe) unterzubringen. Die Orgelsolomesse KV 259 ist die kürzeste Messe Mozarts; der liturgische Text ist straff durchkomponiert, Wortwiederholungen zur Steigerung der Wirkung sind selten. Das Kyrie ist mit 29 Takten das kürzeste, das Mozart jemals schrieb. Im Credo führt die Kürze zu diffuser Polytextur. Das Benedictus, nachträglich um insgesamt 18 Takte gekürzt, zeichnet sich durch den solistischen Orgelpart aus, der in den vierstimmigen Vokalsatz in konzertähnlicher Form eingearbeitet ist. Der erste Teil des Agnus Dei wirkt mit seiner pizzicato begleiteten Violinmelodie wie eine Serenade.
Text aus dem Internet, Autor unbekannt.
Als Solisten hören Sie: Ursula Langmayr, Katrin Auzinger, Samuel Robertson und Klemens Sander
Zum Offertorium erklingt die Kirchensonate C-Dur KV 336 (1780)
In seinen Kirchensonaten KV 244, 245, 263, 328 und 329 hat Mozart dem Organisten nicht nur die improvisatorische Ausführung des Continuo-Parts überantwortet, sondern ihn auch mit solistischen Aufgaben größerer und kleinerer Art bedacht. Seine letzte Kirchensonate, KV 336, ist hingegen ein wenn auch kleines, so doch veritables Orgelkonzert, natürlich nur einsätzig, wie alle Kirchensonaten Mozarts. Die Continuo-Aufgaben hat bei diesem Werk eine zweite Orgel übernommen, das auf der Empore des gegenüberliegenden Kuppel-Pfeilers im Salzburger Dom befindliche Instrument.
Diese Kirchen- oder Epistelsonate – so wurden die Kirchensonaten auch genannt, weil sie im feierlichen Hochamt nach der Epistel anstelle des Gradual-Gesanges erklungen sind – ist im Autograph von Mozart mit März 1780 datiert und damit die einzige Kirchensonate, von der man sagen kann, dass der konzertierende Orgelpart vom Komponisten für sich selbst in seiner Funktion als Salzburger Hoforganist geschrieben wurde. Den Kompositions- und Uraufführungsanlass kennen wir nicht; bei einer im März entstandenen kirchenmusikalischen Komposition wäre es naheliegend, an den Ostersonntag zu denken. Das ist aber bei der bescheidenen Streicherbesetzung nicht möglich, weil diese nicht den Besetzungstraditionen für ein festum pallii entspricht. Vielleicht war es aber das feierliche Hochamt am Ostermontag?
Text: Aus „Mozart sakral“, 2006
Sonntag, 15. Oktober 2023: W.A.MOZART – „Kleine Credomesse“
Missa brevis in F-Dur, KV 192 (1774)
Im August 1754 wurde der 100. Jahrestag der Kirchweihe der vor den Toren Salzburgs liegenden Wallfahrtskirche Maria Plain, mit einer von 13. bis 21. August währenden Festwoche gefeiert, die durch acht Tage täglich feierliche Vormittags- wie Nachmittagsgottesdienste – insgesamt 26 (!) – brachte. Vom 19. August heißt es in einer zeitgenössischen Beschreibung, dass die Musik beim Hochamt besonders schon und künstlerisch gewesen sei, weil „erstlich fast lauter Hochfürstliche Hofmusikanten solches producirt haben: sonderlich aber der alte, und iunge, beyde berühmte Herrn Motzart. Bey welchem der iunge Herr Motzart ein Orgel, und ein Violinkonzert, zu aller Leuthen Verwunderung, und Erstaunung gemacht.“
Man bringt die mit 24. Juni 1774 datierte Missa brevis in F-Dur, KV 192, deren feine kammermusikalische Struktur an einen kleinen Kirchenraum denken lässt, die aber durch (allerdings vielleicht nachkomponierte) Trompeten und Pauken auch genug Festglanz erhält, zurecht mit Maria Plain in Zusammenhang: entweder mit dem Jahr für Jahr am 5. Sonntag nach Pfingsten (1774 am 4. Juli) gefeierten Gedächtnistag der 1751 erfolgten Krönung des Gnadenbildes oder mit den beschriebenen Festlichkeiten zum hundertjährigen Kirchweihfest. Das Credo wird von jenem Motiv angestimmt, das den Schlusssatz der Jupiter-Symphonie prägt, aber auch schon in Mozarts erster Symphonie, KV 16, aufgetaucht ist. Es wird zu den Worten „credo, credo“ mehrmals innerhalb des Satzes wiederholt, womit diese Messe zum Typus der zahlreichen Credo-Messen zu zählen ist, wie auch Mozarts Messe KV 257, die diesen Typus-Namen als Beinamen („Große Credomesse“) erhalten hat. In ihr taucht das Credo-Motiv dieser Messe im Übrigen im Sanctus auf.
Dass Mozart bei diesem Hochamt am 19. August sowohl ein Orgel- wie ein Violinkonzert gespielt hat, informiert uns wieder einmal grundsätzlich über die Funktion der Instrumentalmusik in der damaligen Kirchenmusik: Sowohl der Gradual- wie der Offertoriumsgesang sind bei diesem festlichen Gottesdienst durch ein Instrumentalkonzert ersetzt worden. – Lob Gottes mit Musik, ohne Worte.
Text: „Mozart sakral“, Wien, 2006
Diese Solist*en musizieren mit uns: Ursula Langmayr, Cornelia Sonnleithner, Daniel Johannsen, Felix Pacher
Zum Offertorium hören Sie die Kirchensonate F-Dur, KV 244 (1776)
Diese Kirchensonate aus dem April des Jahres 1776 ist die erste von jenen fünf Kirchensonaten, in denen Mozart die Orgel konzertierend eingesetzt hat. Für Organisten ist interessant, dass Mozart das Orgelsolo ausdrücklich mit der „Copula allein“ gespielt wissen wollte, einem nicht lauten und flötenartig klingenden Register. Diese Registrierungsangabe ist vielsagend für die Intonation von Mozarts Orgel, die Akustik im Salzburger Dom sowie für die Balance und Dynamik in der damaligen Aufführungspraxis.
Text: Aus „Mozart sakral“, 2006
Sonntag, 22. Oktober 2023: Joseph HAYDN – „Kleine Orgelsolomesse“ (1775)
 Die „Kleine Orgelsolomesse“ entstand wahrscheinlich 1775 in Eisenstadt. Sie ist uns als einzige der kleineren Messen Haydns vollständig in Haydns Handschrift erhalten.
Die „Kleine Orgelsolomesse“ entstand wahrscheinlich 1775 in Eisenstadt. Sie ist uns als einzige der kleineren Messen Haydns vollständig in Haydns Handschrift erhalten.
Als „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ ist sie dem Hl. Johannes von Gott (1495-1550) gewidmet, der als Ordensvater der Barmherzigen Brüder gilt. Schon in seinen Jugendjahren hatte Haydn in Wien Kontakt zu den Barmherzigen Brüdern gefunden, und auch mit den Brüdern des Eisenstädter Konvents war er eng befreundet.
„Missa brevis“ bedeutet: kurz in den zeitlichen Dimensionen der einzelnen Sätze (die Aufführungsdauer der Messe beträgt etwa 15 Minuten) und sparsam in der Orchesterbesetzung. Und so treten in diesem Werk zum vierstimmigen Chor erste und zweite Violine, Violoncello, Kontrabass und Orgel.
Um in den textreichen Sätzen des Gloria und Credo die gewünschte Kürze zu erreichen, erklingen in den einzelnen Chorstimmen gleichzeitig verschiedene Texte (Polytextierung). Auf diese Weise erreicht Haydn im Gloria eine rekordverdächtige Kürze (31 Takte, Aufführungszeit etwa 50 Sekunden!). Der Credobeginn und das „Et resurrexit“ sind durch Polytextierung ebenfalls relativ kurz. „Et incarnatus“ und „Crucifixus“ allerdings sind breiter und mit viel Ausdrucksmöglichkeiten gestaltet.
Ein Meisterwerk sakraler Kunst ist das dem Solosopran, gesungen von Ayano Kobayashi, und der konzertierenden Orgel (gespielt von Maximilian Schamschula) anvertraute Benedictus, das von den Streichern zart umspielt wird.
Auch die beiden Ecksätze der Messe – Kyrie (Adagio) und Agnus Dei (Adagio) sind musikalische Kleinode. Besonders das im Pianissimo ganz zart verklingende „pacem“ verleiht dem Werk eine spürbare religiöse Intimität. So ist es kein Wunder, dass die Messe schon zu Haydns Lebzeiten die weiteste Verbreitung fand.
Text: Friedrich Wolf im Booklet unserer CD 279 ORF (2001).
Zum Offertorium spielt das Orchester die Kirchensonate in G-Dur von Mozart.
Im August 1777 hat der Konzertmeister W.A.Mozart um die Entlassung aus den Diensten der Salzburger Hofkapelle gebeten, weil er in der großen musikalischen Welt sein Glück suchen wollte. Eine Reise nach Paris sollte ihm das ermöglichen. Der Erzbischof nahm das Gesuch an und dekretierte, dass er sein „Glück weiter zusuchen die Erlaubniß“ habe. Zu den letzten Werken, die er damals für die Hofkapelle geschrieben hat, zählen die Kirchensonaten KV274 und KV278. Ferner wird vermutet, dass in der ersten Hälfte dieses Jahres auch noch eine Messe (KV275) und ein kleineres Kirchenmusikwerk (KV 277 Offertorium) entstanden sind. Eineinhalb Jahre später ersuchte Mozart um die Wiederaufnahme in die Salzburger Hofkapelle und wurde wieder als Hoforganist angestellt.
Text: Aus „Mozart sakral“, 2006
Dienstag, 24. Oktober 2023, 19:30 Uhr: ABENDKONZERT
W.A. MOZART – Requiem in d-Moll, KV 626 (1791)
Karten/Tickets: +43 664 33 664 64 können ab sofort bestellt werden! Oder nach der Sonntagsmesse am Ausgang.
Vorverkauf/Advance booking: € 35/30
Abendkassa/Box office: € 40/35
Solist*en: Monika Riedler, Sopran; Eva Maria Riedl, Alt; Gernot Heinrich, Tenor; Yasushi Hirano, Bass
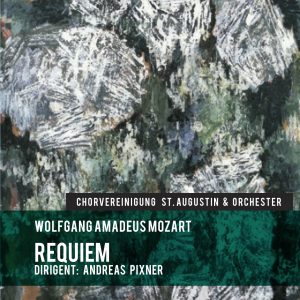 Das Requiem aus dem Jahr 1791 ist Mozarts letzte Komposition. Obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart stammt, ist es eines seiner beliebtesten und am höchsten eingeschätzten Werke. Mozart starb während der Komposition. Da es sich um ein Auftragswerk handelte, vervollständigten Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr, Schüler von Mozart, das Requiem im Auftrag von Constanze Mozart, der Witwe des Komponisten. Die Entstehungsgeschichte und Qualität der nachträglichen Ergänzungen werden seit langem heftig diskutiert. Die ungewöhnlichen Umstände des Kompositionsauftrags und der zeitliche Zusammenhang dieser Seelenmesse mit Mozarts frühem Tod haben zudem eine üppige Mythenbildung angeregt.
Das Requiem aus dem Jahr 1791 ist Mozarts letzte Komposition. Obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart stammt, ist es eines seiner beliebtesten und am höchsten eingeschätzten Werke. Mozart starb während der Komposition. Da es sich um ein Auftragswerk handelte, vervollständigten Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr, Schüler von Mozart, das Requiem im Auftrag von Constanze Mozart, der Witwe des Komponisten. Die Entstehungsgeschichte und Qualität der nachträglichen Ergänzungen werden seit langem heftig diskutiert. Die ungewöhnlichen Umstände des Kompositionsauftrags und der zeitliche Zusammenhang dieser Seelenmesse mit Mozarts frühem Tod haben zudem eine üppige Mythenbildung angeregt.
Es gibt Hinweise auf eine (fragmentarische) Erstaufführung, noch bevor das Werk überhaupt fertiggestellt war, nämlich am 10. Dezember 1791 im Zusammenhang mit den Exequien für Mozart, die Emanuel Schikaneder in der Michaelerkirche zu Wien abhalten ließ, wo sich heute auch eine Gedenktafel befindet, die an dieses Ereignis erinnert. Dort können jedoch allenfalls die ersten beiden Sätze, Introitus und Kyrie, gespielt worden sein, da die anderen noch gar nicht vollständig vorlagen. Mit welchen Instrumenten gespielt wurde, ist unbekannt.
Die Uraufführung des Gesamtwerks fand am 2. Januar 1793 im Saal der Restauration Jahn in Wien statt, wo Mozart 1791 seinen letzten Auftritt als Pianist gehabt hatte. Sie wurde veranstaltet von Gottfried van Swieten im Rahmen eines Benefizkonzerts für Constanze Mozart und ihre Kinder. Die Aufführung scheint sich auf Kopien gestützt zu haben, die Constanze Mozart und Süßmayr vor der Ablieferung der Partitur hatten anfertigen lassen. Vermutlich geschah dies ohne Wissen des Auftraggebers Graf Walsegg, der die Rechte daran besaß.
Erst am 14. Dezember 1793 (in der Stiftskirche des Zisterzienserstiftes Neukloster in Wiener Neustadt) kam es zu der ersten Aufführung, die den Auftragsbedingungen und der ursprünglichen Zweckbestimmung entsprach: als Seelenmesse für die verstorbene Gräfin Walsegg. Der Auftraggeber selbst dirigierte nach dem Bericht eines der beteiligten Musiker das Werk und benutzte dazu eine Partiturabschrift, in die er als Autor sich selbst hatte eintragen lassen – offenbar ein Verfahren, das er häufiger anwandte (und das auch die anonyme Bestellung erklärt). Eine weitere Aufführung fand am 14. Februar 1794, dem dritten Todestag der Gräfin Walsegg, in der Patronatskirche des Grafen, Maria Schutz am Semmering (heute zu Schottwien gehörig), statt.
Über Wien und Wiener Neustadt hinaus verbreitete sich der Ruf des Werks durch eine Aufführung im Konzertsaal des Gewandhauses in Leipzig am 20. April 1796, dirigiert von Johann Gottfried Schicht, dem späteren Thomaskantor. Die Ankündigung ist erhalten geblieben, sodass Genaueres bekannt ist. Nach dem ca. einstündigen Requiem waren weitere Mozartwerke mit zwei Interpreten vorgesehen: Constanze Mozart (Gesang) und August Eberhard Müller (Orgel). Müller war später Redakteur des Erstdrucks der Partitur.In der ersten Biografie Mozarts, die von Franz Xaver Niemetschek 1798 veröffentlicht wurde, findet das Requiem bereits recht ausführlich Erwähnung. Der Fragmentcharakter wird ebenso angesprochen wie die anonyme Bestellung.
Der Verlag Breitkopf & Härtel wandte sich nun im Lauf des Jahres 1799 an Constanze Mozart, um Verhandlungen wegen des Mozart-Nachlasses sowie eines Drucks der Requiem-Partitur aufzunehmen. Während erstere scheiterten, hatten letztere Erfolg – auch deswegen, weil Constanze Mozart nicht über die Rechte an dem Werk verfügte. Der Verlag, der bereits eine Partiturabschrift in Besitz hatte, versuchte von Constanze Mozart genauere Informationen bezüglich des Urheberrechts, der Urheberschaft sowie des genauen Notentextes zu erlangen. Constanze Mozart übersandte Breitkopf & Härtel ihre Partiturabschrift zum Abgleichen des Notentextes und gab dem Verlag den Rat, sich wegen der Einzelheiten der Fertigstellung des Werks an Süßmayr zu wenden. Tatsächlich erklärte Süßmayr in einem Brief vom Februar 1800 an den Verlag, im Wesentlichen wohl korrekt, seinen Anteil am Requiem, scheint aber nicht auf Nennung seines Namens gedrängt zu haben – denn bald darauf erschien der Erstdruck der Partitur bei Breitkopf & Härtel, der als Autor lediglich Mozart angab, einen eindeutigen Notentext lieferte und den Fragmentcharakter des Werkes in keiner Weise erkennen ließ.
Durch die Zeitungsinserate, mit denen der Verlag für das Werk warb, wurde jedoch auch Graf Walsegg aufmerksam, trat aus seiner Anonymität heraus und stellte Forderungen an Constanze Mozart, die offenbar durch einen Kompromiss abgegolten werden konnten. Wohl auf sein Drängen hin, vielleicht aber auch im Interesse Constanze Mozarts, die dem Musikverleger Johann Anton André, dem Erwerber des Mozart-Nachlasses, gern die Originalpartitur beschafft und verkauft hätte, kam es zudem im Herbst 1800 zu einem denkwürdigen Treffen in der Wiener Notariatskanzlei von Dr. Johann Nepomuk Sortschan, der für Walsegg agierte. Dabei lagen alle wichtigen Handschriften vor: die „Ablieferungspartitur“, die der Graf erhalten hatte; die „Arbeitspartitur“, die damals im Besitz von Constanze Mozart war; dazu ein Exemplar des Erstdrucks von Breitkopf & Härtel. Maximilian Stadler und Georg Nikolaus Nissen (Constanze Mozarts zweiter Mann) vertraten die Familie Mozart. Stadler hatte den Nachlass Mozarts geordnet, kannte daher Mozarts Handschrift gut und war vermutlich auch an der Instrumentation des Offertoriums beteiligt gewesen; ihm fiel daher die Aufgabe zu, die Teile Mozarts und Süßmayrs zu trennen. Dies geschah u.a. durch „Einzäunen“ der nicht von Mozart stammenden Passagen mit einer „Bleyfeder“ in der „Arbeitspartitur“. Das Ergebnis dieser Kollationierung wurde vom Notar festgehalten und Geheimhaltung vereinbart. Dann kehrten die Originale wieder zu ihren Besitzern zurück.
Im Grunde gab es erst jetzt wirklich ein „Mozart-Requiem“ als einheitliches Werk: Die rechtlichen Fragen waren geklärt, eine Partiturausgabe existierte auf dem Markt und wurde bald durch einen Klavierauszug (erschienen bei André 1801) und Stimmausgaben (1812 in Wien) ergänzt (durchweg mit Mozart als allein genanntem Verfasser), Aufführungen, Partiturstudium und Rezensionen waren möglich. Andererseits war auch der Anteil von Süßmayr bekannt, denn sein oben angeführter Brief an Breitkopf & Härtel wurde 1801 in der Allgemeinen musikalischen Zeitung abgedruckt. Bis 1825 wurde die Werkgestalt nicht mehr nennenswert öffentlich diskutiert.
Quelle: Wikipedia
Montag, 1., Allerheiligen: Franz SCHUBERT – Messe Nr. 2 in G-Dur (1815)
 Nach der großen und feierlichen F-Dur-Messe aus dem Jahr 1814 war die Missa brevis in G-Dur, die nach der Datierung auf der autographen Partitur zwischen dem 2. und 7. März 1815 entstand, ein eher „kammermusikalisches“ Werk, die Besetzung umfasst in der ursprünglichen Fassung nur drei Solisten STB, Chor SABT, zwei Violinen, Viola und Basso continuo, bestehend aus Streicherbass und Orgel. In dieser Version wurde die Messe auch in der Lichtentaler Pfarrkirche aufgeführt, vermutlich unter Schuberts eigener Leitung. Da er für die Komposition die Arbeit an seiner 2. Sinfonie unterbrach, wird vermutet, dass er von Michael Holzer, dem Regens chori an der Lichtentaler Pfarrkirche, um eine derartige Messe gebeten worden war. Die kleine Besetzung weist sie als „normale Sonntagsmesse“ aus. Es wurde lange angenommen, dass zusätzliche Stimmen für Pauken und Trompeten Nach der großen und feierlichen F-Dur-Messe aus dem Jahr 1814 war die Missa brevis in G-Dur, die nach der Datierung auf der autographen Partitur zwischen dem 2. und 7. März 1815 entstand, ein eher „kammermusikalisches“ Werk, die Besetzung umfasst in der ursprünglichen Fassung nur drei Solisten STB, Chor SABT, zwei Violinen, Viola und Basso continuo, bestehend aus Streicherbass und Orgel. In dieser Version wurde die Messe auch in der Lichtentaler Pfarrkirche aufgeführt, vermutlich unter Schuberts eigener Leitung. Da er für die Komposition die Arbeit an seiner 2. Sinfonie unterbrach, wird vermutet, dass er von Michael Holzer, dem Regens chori an der Lichtentaler Pfarrkirche, um eine derartige Messe gebeten worden war. Die kleine Besetzung weist sie als „normale Sonntagsmesse“ aus. Es wurde lange angenommen, dass zusätzliche Stimmen für Pauken und Trompeten ad libitum (ein außerordentlich wirkungsvoller Zusatz!) später von Schuberts Bruder Ferdinand mit Zustimmung des Komponisten anlässlich einer Aufführung im Chorherrenstift Klosterneuburg bei Wien ausgeführt wurden. Erst in den 1980er-Jahren wurde von Bernhard Paul in Klosterneuburg der originale, von Schubert eigenhändig um Pauken und Trompeten erweiterte Stimmensatz aufgefunden. Dieser Stimmensatz enthält auch kleinere Änderungen „von letzter Hand“ im gesamten Werk. In dieser Fassung fand die erste belegte Aufführung erst am 11. Juli 1841 in Klosterneuburg statt. Der Zeitpunkt der Erweiterung ist allerdings unbekannt. Ferdinand Schubert ergänzte jedoch die Messe 1847 noch um zusätzliche Stimmen für zwei Oboen oder Klarinetten und Fagotte. Die Messe in G-Dur wird als eines der bedeutendsten Jugendwerke des damals erst 18-jährigen Komponisten angesehen und gilt unter den vier frühen Messen als die gelungenste.
Nach der großen und feierlichen F-Dur-Messe aus dem Jahr 1814 war die Missa brevis in G-Dur, die nach der Datierung auf der autographen Partitur zwischen dem 2. und 7. März 1815 entstand, ein eher „kammermusikalisches“ Werk, die Besetzung umfasst in der ursprünglichen Fassung nur drei Solisten STB, Chor SABT, zwei Violinen, Viola und Basso continuo, bestehend aus Streicherbass und Orgel. In dieser Version wurde die Messe auch in der Lichtentaler Pfarrkirche aufgeführt, vermutlich unter Schuberts eigener Leitung. Da er für die Komposition die Arbeit an seiner 2. Sinfonie unterbrach, wird vermutet, dass er von Michael Holzer, dem Regens chori an der Lichtentaler Pfarrkirche, um eine derartige Messe gebeten worden war. Die kleine Besetzung weist sie als „normale Sonntagsmesse“ aus. Es wurde lange angenommen, dass zusätzliche Stimmen für Pauken und Trompeten Nach der großen und feierlichen F-Dur-Messe aus dem Jahr 1814 war die Missa brevis in G-Dur, die nach der Datierung auf der autographen Partitur zwischen dem 2. und 7. März 1815 entstand, ein eher „kammermusikalisches“ Werk, die Besetzung umfasst in der ursprünglichen Fassung nur drei Solisten STB, Chor SABT, zwei Violinen, Viola und Basso continuo, bestehend aus Streicherbass und Orgel. In dieser Version wurde die Messe auch in der Lichtentaler Pfarrkirche aufgeführt, vermutlich unter Schuberts eigener Leitung. Da er für die Komposition die Arbeit an seiner 2. Sinfonie unterbrach, wird vermutet, dass er von Michael Holzer, dem Regens chori an der Lichtentaler Pfarrkirche, um eine derartige Messe gebeten worden war. Die kleine Besetzung weist sie als „normale Sonntagsmesse“ aus. Es wurde lange angenommen, dass zusätzliche Stimmen für Pauken und Trompeten ad libitum (ein außerordentlich wirkungsvoller Zusatz!) später von Schuberts Bruder Ferdinand mit Zustimmung des Komponisten anlässlich einer Aufführung im Chorherrenstift Klosterneuburg bei Wien ausgeführt wurden. Erst in den 1980er-Jahren wurde von Bernhard Paul in Klosterneuburg der originale, von Schubert eigenhändig um Pauken und Trompeten erweiterte Stimmensatz aufgefunden. Dieser Stimmensatz enthält auch kleinere Änderungen „von letzter Hand“ im gesamten Werk. In dieser Fassung fand die erste belegte Aufführung erst am 11. Juli 1841 in Klosterneuburg statt. Der Zeitpunkt der Erweiterung ist allerdings unbekannt. Ferdinand Schubert ergänzte jedoch die Messe 1847 noch um zusätzliche Stimmen für zwei Oboen oder Klarinetten und Fagotte. Die Messe in G-Dur wird als eines der bedeutendsten Jugendwerke des damals erst 18-jährigen Komponisten angesehen und gilt unter den vier frühen Messen als die gelungenste.
In mancher Hinsicht ähnelt die G-Dur-Messe der ein Jahr vorher entstandenen F-Dur-Messe, ist aber im Vergleich zu dieser wesentlich geschlossener in der Form. Während Haydn oder Beethoven Meister in der Kunst waren, den liturgischen Text musikalisch zu charakterisieren, liegt die Stärke Schuberts darin, eine allgemeine andächtige Stimmung zu schaffen, und zwar auch in den traditionell „textlastigen“ Sätzen des Gloria und des Credo. In der G-Dur-Messe scheute er zu diesem Zweck auch vor Neuerungen nicht zurück: So beginnt im Credo die Reprise des Anfangsmotivs erst bei den Worten „et in spiritum sanctum“, um die Lehre von der Dreifaltigkeit als Basis des Glaubensbekenntnisses auch musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Ebenfalls neu ist im Agnus Dei die gleichartige Behandlung des „Miserere“ und des „Dona nobis pacem“ als Refrain, ohne Takt- oder Tempowechsel und auf dasselbe Motiv. Das „Dona nobis“ ist sehr knappgehalten und umfasst ohne die zwei Takte Orchesternachspiel nur vier Takte von insgesamt 44 Takten. Insgesamt ist die Messe sehr eingängig und weitgehend homophon gesetzt, und auch in den wenigen solistischen Einwürfen ohne größere technische Schwierigkeiten, was vermutlich zu ihrer weiten Verbreitung beigetragen hat. Lediglich das „Hosanna“ in Benedictus und Sanctus ist als Fugato angelegt und das für das Solistenterzett geschriebene Benedictus als Kanon. Ansonsten lässt Schubert wie in allen seinen Messen im Credo das „…et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“ („[Ich glaube an] die eine, heilige katholische und apostolische Kirche“) weg, sowie zusätzlich in dieser Messe das „Et expecto resurrectionem mortuorum“ („Ich erwarte die Auferstehung der Toten“).
Nach dem Tode Schuberts im Jahr 1828 blieb die G-Dur-Messe zunächst weitgehend unbeachtet. Dies ist insofern unverständlich, da sie heute die populärste und im liturgischen Gebrauch am häufigsten aufgeführte Messe Schuberts ist. Sie war sogar so unbekannt, dass sie das Objekt geistigen Diebstahls werden konnte: Sie wurde erstmals im Jahr 1846 in Prag gedruckt, allerdings als Raubkopie unter dem Komponisten Robert Führer“. Dieser war zeitweilig einer der führenden und bekanntesten Kirchenmusiker in Österreich-Ungarn und bis 1845 Domkapellmeister am St.-Veits-Dom in Prag. Sein Plagiat der G-Dur-Messe wurde 1848 von Schuberts Bruder Ferdinand aufgedeckt. Erst langsam wurde die Bedeutung dieses Werkes erkannt: Unter Johann Franz Ritter von Herbeck wurde sie zusammen mit den anderen Messen Schuberts während seiner Zeit als Hofkapellmeister in das Repertoire der Wiener Hofkapelle aufgenommen.
Text aus dem Internet, Autor unbekannt.
Solistin und Solisten: Elisabeth Wimmer, Alexander Kaimbacher, Klemens Sander
Dirigent: Tom Böttcher